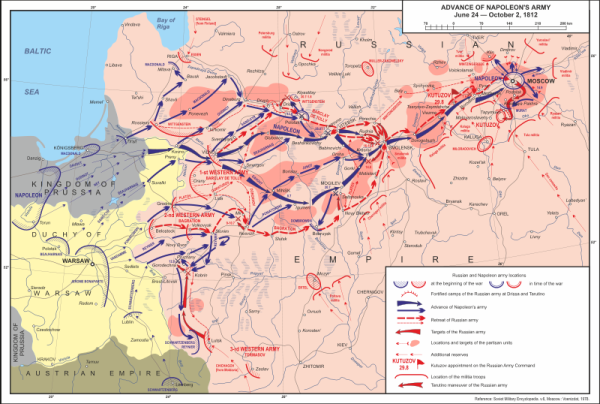„Gute Geschichten sind leise, deshalb lauscht man ihnen.“ Georg-Wilhelm Exler
Schon als kleines Kind faszinierten mich die vielen unterschiedlichen Charaktere, die es in meiner großen Familie zu geben schien und deren mütterlicher – evangelischer – Zweig aus der Elbe-Weser-Region in Norddeutschland stammt, während der katholische Zweig in Hirschau bzw. Wurmlingen zwischen Rottenburg und Tübingen verwurzelt ist.
Meine norddeutsche Großmutter Margaretha von Hassel erzählte gern und viel von alten Zeiten, Ereignissen, die in ihrem Leben wichtig gewesen waren oder Menschen, die sie geprägt hatten, und ich lauschte hingerissen ihren mit plattdeutschen Ausdrücken gespickten Geschichten. So wurde mein Interesse an der Familie und später der Familiengeschichte geweckt – das sich zwischenzeitlich zu einer wahren Passion entwickelt hat, denn meine Familien- bzw. Ahnenforschung ist mittlerweile weit mehr als ein Hobby.
Hier möchte ich nun andere an meinen Forschungsergebnissen teilhaben lassen. Aus Gründen der Lesbarkeit verzichte ich weitgehend auf Quellenangaben. Im Original habe ich aber natürlich alles äußerst sorgfältig dokumentiert.
Möglicherweise finden sich so auch weitere Familienangehörige, von denen manche in Bremen und Frankfurt (Familie de Reese) oder sogar in Amerika leben (Familie Lohse, Familie von Hassel, Familie Haug u.a.). Gerne können Interessierte mit mir via Facebook Kontakt aufnehmen.
Den Blog habe ich HUGOs Geschichte(n) genannt, weil sich mein Familienname auf diesen im Mittelalter weit verbreiteten Vornamen zurückführen lässt.
Wurzeln im Schwäbischen – Geschichte des Dorfes Hirschau
Die Vorfahren meiner väterlichen Familie stammen aus dem schwäbischen Hirschau und lassen sich dort bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts zurückverfolgen. Mein direkter Vorfahre Johannes Evangelist Haug wanderte zu Beginn des 19. Jahrhunderts aber in das Nachbardorf Wurmlingen ab, um sich dort zu verehelichen. Darüber werde ich noch berichten.
Sein Heimatort Hirschau liegt je sechs Kilometer von der heutigen Universitätsstadt Tübingen und der Bischofsstadt Rottenburg am Neckar entfernt und wird vom Spitzberg flankiert.
Die ersten Ansiedlungen in der Markung Hirschau entstanden um 200 vor Christus, ein Ur-Dorf dürfte im zweiten bzw. dritten Jahrhundert nach Christus entstanden sein, als sich die Alamannen im Südwesten Deutschlands niederließen, denn die ersten Zeugnisse über die Besiedlung stammen aus der Urnenfelder- und Alamannenzeit. Aus der Römerzeit sind nur spärliche Bruchstücke zu verzeichnen. So vermutet man bei der Ödenburg auf dem Spitzberg Reste eines kleinen römischen Heiligtums, weitere römische Baureste nimmt man an der Gemarkungsgrenze zu Wurmlingen an der Talweitung des Neckars an, ca. 1 km südwestlich von Hirschau. Sehr wahrscheinlich bestanden schon vor der Erbauung des Dorfes einzelne Gehöfte.
Im Jahr 1204 wurde der Herkunftsort der Familie Haug als Hirzouue erstmals in einem Verzeichnis des Zisterzienserklosters Bebenhausen urkundlich erwähnt.
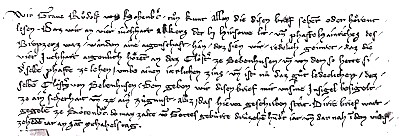
1381 verkaufte Graf Rudolf III. von Hohenberg seine Herrschaft an Herzog Leopold von Österreich, wodurch Hirschau vorderösterreichisch wurde; daher war die Mehrheit der Bevölkerung – im Gegensatz zu Tübingen – überwiegend katholisch.
Im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit war Hirschau übrigens das bevölkerungsreichste Dorf in Niederhohenberg, was zweifellos auf den intensiven Weinbau zurückzuführen ist und zumindest bei einigen Einwohnern zu einem gewissen Wohlstand führte. Im Vergleich zu anderen Dörfern war hier der Anteil der Armen allerdings umso höher.
Bereits für das späte 13. Jahrhundert ist am Spitzberg die Anlage eines Weinbergs in Hirschau nachgewiesen. Einen der frühesten Belege für Weinbau am Spitzberg bietet die hohenbergische Steuerliste aus dem Jahr 1394, worin der Nachbarort Wurmlingen mit 69 Steuerzahlern und einem Gesamtvermögen von 4221 Pfund Heller (lb. hl.) verzeichnet ist.
Im 16. Jahrhundert umfasste der Hirschauer Weinbau eine ca. 280 Morgen große Anbaufläche für Rebsorten wie Sylvaner, Elbling, Trollinger oder Putzscheeren. Neben der Landwirtschaft spielte der Weinbau also eine wichtige Rolle und viele Einwohner Hirschaus werden in den Kirchenbüchern auch als Weinbauern, Wengerter oder Rebmänner bezeichnet. Zeitweise wurden im Dorf bis zu sechs Keltern betrieben, wovon einzig die dem Kloster Kreuzlingen gehörende Riedkelter noch erhalten ist.
Das Dorf
Das Bild des von Weingärten, Baumwiesen und Äckern umgebenen und am Neckar gelegenen Wege- oder Kettendorfes am Fuße des Spitzberges, das im schwäbischen Dialekt Hirschen genannt wird, prägten die mit roten Ziegeln gedeckten Fachwerkbauten, die sich an einer langen, breiten Straße aufreihten, von der kurze Stichstraßen abgingen.

In den meist zweistöckigen Wohnhäusern (die Giebelseite gegen die Straße und der Eingang an der Längsseite), den sogenannten Einhäusern mit Stall und Scheune unter einem Dach, befanden sich über dem Stall die Stube, Kammern und Küche, daneben die Scheuer mit Tenne, Wagenremise und Abort.
Die Häuser hatten seit den Josephinischen Reformen eine Nummer, Straßenbezeichnungen gab es aber noch nicht. Als Lagebezeichnung wurde etwa verwendet: Vor dem Tor, Oben im Dorf, In der Kirchgasse, Mitten im Dorf, Bei der Zehntscheuer, Unten im Dorf, Bei der Kirche, Beim oberen Tor, Auf dem Bühl.
In den kleineren Gassen standen auch eingeschossige Kleinbauernhäuser.
Das zum Bau eines Hauses benötigte Holz erhielt der Bauherr auf Anfrage aus dem Gemeindewald. Es wurde ebenso wie die Bausteine mit Fuhrwerken kostenlos von den Bauern herbeigeschafft. An den Dächern waren hölzerne Dachrinnen angebracht, die das Regenwasser in die Brunnen leiteten. Das Fachwerk wurde durch kräftige Farbe betont (zum Anstreichen der Holzbalken verwendete man frisches Rinderblut) und Ringelfelder mit Kalk geweißelt. Vor dem Haus befand sich die Dunglege. Oft gehörte zu den Hirschauer Häusern ein Obst- und Gemüsegarten.
Im Ort gab es neben dem Mesnerhaus, der Zehntscheuer und mehreren Keltern auch ein Rathaus. Leider brannte es am 5. Dezember 1923 ab, wodurch die Urkunden der vergangenen Jahrhunderte (Ortsarchiv) verloren gingen. Das im Jahre 1793 neu erstellte Gebäude an der Hauptstraße war zuvor „eine Zierde des so prachtvoll an den Fuß der Wurmlinger Kapelle gebetteten Hirschau“ und beherbergte eine Arrestzelle, eine Backküche und die Schule mit einem Klassenzimmer und einem Lehrer (der gleichzeitig Mesmer war), aber zwei Klassen, die abwechselnd vor- und nachmittags unterrichtet wurden.
Das dem Rathaus angeschlossene Backhaus war ein Lehen der Herrschaft Hohenberg, die die „Backkuch und Brot-Taferei“ zu Hirschau von 1483 bis 1775 an Hirschauer Bürger vergab, unter anderem an meinen 1695 geborenen Vorfahren Petrus Haug, der im Jahre 1735 als Lehensnehmer genannt wird.
Das in der „Backkuch“ gebackene Weißbrot war aus Kornmehl, das man neben Gerstenmehl auch zur Herstellung von Schwarzbrot verwendete. Den Seilzopf, ein beliebtes Feiertagsbackwerk, und Kuchen gab es nur an Feiertagen. An Arbeitstagen aßen die Menschen morgens Suppe oder Milch, in die Schwarzbrot eingebrockt wurde. Das Vormittagsvesper bestand aus einem Stück Schwarzbrot und Äpfeln, wobei die Erntezeit und die „Heuet“ eine Ausnahme machten. Sonntags gab es zum Mittagessen Suppe und etwas Fleisch, an den übrigen Wochentagen kamen Kartoffelschnitz, Kraut, Knöpfle oder Spätzle auf den Tisch. Nachmittags versperte man trockenes Brot und trank Most dazu. Während der Ernte und auch im Heuet wurde beim Vesper Quark (Weißkäse) aufs Brot gestrichen. Zum Trinken nahm man Most in Steinkrügen mit auf die Felder und Wiesen. Abends gab es Milchsuppe (g’standne Milch), in die man wieder Schwarzbrot einbrockte.
Eine Mauer um das Dorf ist auf historischen Karten Hirschaus nicht zu erkennen, eingefasst war es aber wohl von einem sogenannten Etterzaun, einem Holzzaun also, in dem mehrere Tore erforderlich waren. Möglicherweise umgaben auch Wälle und verschiedenen Gräben und Hecken (der „biologische Stacheldraht des Mittelalters“) das Dorf, die aber eher dazu gedacht waren, das Wild und Räuber abzuhalten als eine größere Zahl bewaffneter Feinde.
Am Ortsausgang Richtung Wurmlingen stand ein großes, im Untergeschoss massives Torhaus (Oberes Tor), und auch in Richtung Tübingen musste man am Ortsausgang ein Torhaus (Tübinger oder Unteres Tor) passieren. Die Tore werden 1445, 1485, 1667 und 1715 genannt, außerdem wird in einem Fischwasser-Brief aus dem Jahr 1667 ein Torhaus erwähnt. Die Außenseite des Tübinger Tors schmückte ein Relief mit dem österreichischen Doppeladler, der Torbogen bestand aus behauenen Steinen und war so hoch, dass ein beladener Heu- oder Erntewagen passieren konnte. Die Toräcker weisen noch heute auf die ehemaligen Tore hin.
Hirschau gehörte kirchlich teils zu den Pfarreien Sülchen (Rottenburg), teils zur Pfarrei auf dem Wurmlinger Berg. Seit 1461 war es eine selbständige Pfarrei, der alle Einwohner zugewiesen wurden. Das Patronat lag beim Kloster Kreuzlingen am Bodensee und bis zur Säkularisation wurde die Seelsorge von Geistlichen des Klosters Kreuzlingen wahrgenommen.
1360/1396 wurde die Wallfahrtskapelle Zu unserer lieben Frau im Holderbusch und St. Urban erbaut, die im 15. Jahrhundert errichtete Pfarrkirche St. Ägidius ersetzte diese aber 1434. Der (schiefe Wehr)Turm der Dorfkirche diente den Menschen in Kriegszeiten übrigens als Bergfried. 1780 wurde dem Turm ein vierseitiger Helm aufgesetzt. Eine Statue des Kirchenpatrons stammt aus der Zeit um 1500. Der Heilige Ägidius, ein griechischer Kaufmann, Abt eines Klosters in Südfrankreich und einer der Vierzehn Nothelfer, war im Mittelalter sehr populär. Im Chor, an den Seitenaltären und an den Seitenwänden befinden sich noch heute weitere Heiligenfiguren.
Pomper
Brach im Ort ein Brand aus, wurde durch das Läuten der Kirchenglocken Feueralarm ausgelöst. Mit Feuereimern, die auf dem Rathaus aufbewahrt wurden, eilten die Dorfbewohner (Männer wie Frauen) zum Brandplatz und bildeten von dort bis zu den Brunnen eine lange Kette, in der sie die vollen Feuereimer von Hand zu Hand reichten. Buttenträger trugen das Wasser in Butten zum Brandplatz. Buttenträger waren eientlich die Arbeiter, die bei der Weinlese das Lesegut in einem Behälter (der Butte) auf dem Rücken trugen. Diese hatten ein Volumen von rund 60 bis 80 Liter und werden noch heute im Steillagenweinbau eingesetzt. Früher waren Butten aus Holz oder Weidengeflecht, später aus Blech oder Aluminium. Diese Behälter wurden aber nicht nur zur Traubenlese gebraucht, sondern auch für den Werkzeugtransport (Hacken, Schaufeln, Sicheln) und wurden außerdem eingesetzt, um abgeschwemmte Erde zurück zu tragen oder Unkräuter und Rebentriebe als Viehfutter mitzunehmen.
Im 19. Jahrhundert gab es dann eine organisierte Feuerwehr im Dorf und bis 1860 wurden die Feuerwehrmänner als Pomper bezeichnet.
Ein Spital gab es in Hirschau nicht. Der Oberamtsarzt und der Oberamtswundarzt waren für die Behandlung der Dorfbewohner zuständig und damit auch Armenärzte.
Wichtig für das Dorfleben war auch das seit mindestens 1334 bestehende Wirtshaus (Taverne), in dem sich die Hirschauer trafen (nach dem Lagerbuch der Pflege Roseck wurde 1743 von der Hirschauer Wirtschaft ein jährliches Taverngeld für Wein und Bier erhoben). Aus vorderösterreichischen Regierungsakten geht hervor, dass am 19. Mai 1792 das Gesuch des Fidel Werz, der um Genehmigung zur Errichtung einer Bräustatt bat, bewilligt wurde. Die Bierbrauerei von Fidel Werz prosperierte trotz des Hirschauer Weinbaues.
An der Hirschauer Friedhofskapelle St. Urban steht heute ein Steinkreuz, das wohl mit einem Sühnevertrag von 1514 in Zusammenhang gebracht werden kann. Der durch eine österreichische Kommission in Rottenburg vermittelte Vertrag vom August 1514 bezüglich des schon länger zurückliegenden Totschlags an Hans Rümein in Hirschau bestimmte, dass die elf Täter 50 Messen durch 20 Priester lesen lassen, am Bußtag barfuß, in schwarzen Klagkappen gehüllt an der Grabprozession teilnehmen und sich kreuzweise auf das Grab legen sollten. Zusätzlich hatten sie ein steinernes Kreuz an einem Standort nach Wahl der Hinterbliebenen aufzustellen (vermutlich eines der noch vorhandenen Kreuze), außerdem drei beglaubigte Wallfahrten nach Einsiedeln, Stams und Ötting zu unternehmen. An die Hinterbliebenen mussten sie 100 rheinische Gulden zahlen, an die Obrigkeit 40. Sie erhielten außerdem zwischen zwei und vier Jahren Ortsverbot.

Der Sühnevertrag von 1514 könnte sich allerdings auch auf ein weiteres erhaltenes Sandsteinkreuz im Oberen Gewann mitten im Acker zwischen zwei Feldern auf einem kleinem unbebauten Zwickel, südlich der Wurmlinger Kapelle beziehen. Vor der Flurbereinigung führte am Kreuzäcker ein Fußweg vorbei, der sogenannte „Fußweg nach dem oberen Gewand“. Die Oberamtsbeschreibung von 1899 erwähnt den Fußweg südwestlich von Hirschau zwischen oberem Gewand und Romboscher. Zwar verbergen sich etliche Kreuze in Wiesen, nur selten steht aber ein Steinkreuz mitten auf bewirtschafteter Fläche, was ein Hinweis auf einen ehemaligen Weg ist.

Schulgeschichte
Die Schulgeschichte begann in Hirschau eigentlich erst mit der Reform der österreichischen Kaiserin Maria Theresia 1774, die wollte, dass „jedermann die Gelegenheit verschafft werde, sich die Grundsätze des Christentums so wie die Pflicht seines künftigen Berufs als Bürger des Staats in der zarten Jugend bey zu legen“. Die Schulpflicht (die in Württemberg im Übrigen schon seit 1559 bestanden hatte!) galt nun für sechs- bis zwölfjährige Jungen und Mädchen gleichermaßen und bestand das ganze Jahr über. Der Schulbesuch wurde jetzt jedoch kontrolliert und die Nichtbefolgung der Schulpflicht durch Geldstrafen oder öffentliche Arbeiten sanktioniert. Für die Kinder bedeutete dies eine Entlastung von der Arbeit in der Landwirtschaft, doch den Eltern fehlten die Arbeitskräfte, weshalb sie von der Durchsetzung der Schulpflicht nur wenig begeistert waren.
Nach dem Ende der Schulzeit mussten die Jugendlichen bis zur Vollendung des zwanzigsten Lebensjahres sonntags nach dem Gottesdienst an Wiederholungsstunden teilnehmen. Der Unterricht diente allerdings in erster Linie der religiösen Unterweisung und wurde daher von der katholischen Kirche organisiert. Neben dem Katechismus standen aber auch Lesen, Schreiben und Rechnen auf dem Stundenplan. Wer über diese Fertigkeiten verfügte, konnte eine Funktion in der obrigkeitlichen Verwaltung einnehmen. Allerdings stellte ein Oberamtmann nach einer Schulvisitation fest: „Mit besonderem Mißvergnügen haben wir uns vortragen lassen, daß die Schule zu Hirschau in einem sehr schlechten Zustand sey“. Viele Hirschauer Kinder hatten keinen Schulabschluss, wurden sie doch als Arbeitskräfte in der Landwirtschaft benötigt, und auch die sonntäglichen Wiederholungsstunden fanden nicht statt. Während des Sommers wurde die Schulpflicht auf drei Tage reduziert.
An dieser Stelle folgt nun zunächst ein Artikel von Barbara Kink zur Ernährung in der frühen Neuzeit, den ich leicht bearbeitet habe. Vieles von dem, was Kink ausführt, traf sicherlich auch auf die Bevölkerung Hirschaus zu.
„Qualität, Quantität und Zusammensetzung der Nahrung war im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit vor allem eine Frage der sozialen Zugehörigkeit. Der kirchliche Kalender strukturierte die Essgewohnheiten für alle Bevölkerungsschichten. Sozial schwache Schichten hatten aufgrund der für Nahrungsmittel aufzubringenden Kosten oftmals Schwierigkeiten, sich angemessen zu versorgen. Durch das Witterungsgeschehen und Naturkatastrophen ausgelöste Hungerkrisen führten immer wieder zu Unterversorgung. Die jahrhundertelang nur wenig veränderten Ernährungsgewohnheiten wandelten sich erst seit dem Ende des 18. Jahrhunderts und im Zuge der einsetzenden Industrialisierung. [] Ernährungsgewohnheiten von nicht industrialisierten und traditionellen agrarischen Gesellschaften weisen ein hohes Maß an Beharrungsvermögen auf. Dennoch hatten regionale Besonderheiten des Anbaus von Feldfrüchten und der Viehhaltung Einfluss auf die Ernährung. Abgesehen von einigen regionalen Besonderheiten […] orientierten sich Ernährungsmuster vor allem an den spezifischen Boden- und Klimagegebenheiten einer Region und nicht an Grenzen. Eine weitere Tatsache, die für das Mittelalter und die Frühe Neuzeit generell gilt, ist: Weniger regionale als soziale Zugehörigkeiten entschieden über die Zusammensetzung, Qualität und Quantität der Nahrung, die auf den Tisch kam. […] Der überwiegende Teil der Bevölkerung ernährte sich von den landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die jeweils jahreszeitlich und lokal verfügbar waren. Getreide war der wichtigste Kalorienlieferant und wurde in Form von Brot, einer Vielzahl von Mehlspeisen („Küchel“ und „Nudeln“) sowie Getreidebreien konsumiert. Dabei wurden in Bayern vor allem die weniger anspruchsvollen Getreidesorten Roggen (Korn), Dinkel (Feesen oder Kern) und Gerste angebaut und verzehrt. Gegessen wurde das ganze Korn. Stark ausgesiebte Feinmehlprodukte aus dem sog. Mundmehl wie Weißbrot, Semmeln oder süßes Feingebäck waren den adeligen und wohlhabenderen städtischen Konsumentenkreisen vorbehalten. Während der immer wieder auftretenden Hungerkrisen wurde das Brot mit gemahlenen Kastanien, Wurzeln, Rüben und kleingeheckseltem Stroh gestreckt. Neben dem „täglich Brot“ bzw. Getreide war es vor allem das durch Milchsäuregärung relativ einfach zu konservierende Sauerkraut, das als Vitamin-C-Spender eine wichtige Bedeutung in der Ernährung besaß. Die Weißkrautpflanzen, die bereits seit der Bronzezeit nachweisbar sind, zog man zunächst im Wurzgarten und pflanzte sie dann auf den zu den Dörfern gehörigen Krautgärten aus. Hans Sachs (1494-1576) schrieb 1560: „Bayerland hat die freyheit, isst kraut mit Löffeln alle zeit, all tag zwey kraut, mach ein jahr siben hundert kraut, darzu dreißig.“ […] Erbsen (Arbes), Linsen und Rettich gehörten zu den weit verbreiteten Gemüsesorten. Verschiedene Kohl- und Rübengemüse wie Lauch, gelbe Rüben, Kürbisse, Gurken, Fenchel und Linsen wurden von der Bevölkerung in ihren Hausgärten angebaut. Eine weitere Konservierungsmethode, die im Mittelalter neben der Milchsäuregärung angewendet wurde, war das Trocknen von Lebensmitteln (dies etwa im Fall [von Fisch]), das Räuchern (z. B. beim Schinken), das Dörren von Obst (Äpfel, Birnen, Weinbeeren), das Einsalzen bzw. das Pökeln von Fleisch, das Einlegen von Obst in Form von Kompotten oder das Beizen in Essig oder Wein. Der Fleischkonsum der Menschen war im Lauf des Mittelalters größeren Schwankungen ausgesetzt und hing nicht zuletzt mit der Entwicklung der Bevölkerungszahlen zusammen. So geht man bei den entsprechend niedrigen Bevölkerungszahlen im frühen Mittelalter und nach den großen Pestwellen im 14. Jahrhundert von einem relativ hohen Fleischkonsum (von bis zu durchschnittlich 100 kg Fleisch im Jahr pro Kopf) der Bevölkerung aus. Dies gilt jedoch nur für kurze zeitliche Phasen und war zudem regional begrenzt. Der Befund wird gestützt durch Quellen, die das Nahrungsmittelangebot in spätmittelalterlichen Spitälern wiedergeben. Bevorzugt konsumiert wurde fettes Schweinefleisch, das man dem mageren Rindfleisch vorzog, wobei das ganze Tier samt Innereien und dem […] beliebten „Kesselfleisch“ Verwendung fand. Auch Hühner, Gänse, Lämmer und heimische Fischarten waren beliebte Nahrungsmittel. Tierisches Eiweiß in Form von Milch und Milchprodukten wie Rahm, Butter, Butterschmalz, Rührmilch und Topfen wurde vergleichsweise wenig konsumiert. Käse kam in Form von Frischkäse auf den Tisch. Als ernährungsphysiologisch äußerst wertvoll wurden generell alle Fett- bzw. Kalorienträger betrachtet. Der Schmalztopf war der wie ein Augapfel gehütete Schatz des Haushalts.
Insbesondere die Ressource Wald besaß eine wichtige Bedeutung als Nahrungsmittelspender. Man bezog Eicheln zur Schweinedechel (dazu trieb man die Tiere in den Wald zur Weide), Bucheckern, Pilze, Nüsse und Beeren aus ihm. Die freie Nutzung der Wälder und der Fischfang in den Gewässern bot denn auch immer wieder Konfliktstoff und war oftmals Ausgangspunkt lokaler bäuerlicher Erhebungen. Nur widerwillig nahm man hin, dass Wildschweine, Hirsche und Rehe eine reine Herrenspeise sein sollten. Auch Wachteln, Sperlinge, Reiher, Kraniche, Fasane und Rebhühner bereicherten die gehobenen Speisetafeln. Während man im bäuerlichen Milieu mit den Fischarten aus den heimischen Gewässern wie Hausen oder Forellen Vorlieb nehmen musste, waren Hecht, Aal und Barsch meist Herrenspeisen in der Fastenzeit.
Aus dem Hausgarten bezog man Kräuter wie Petersilie, Schnittlauch oder Liebstöckel. Dennoch war der bäuerliche Haushalt nicht autark, sondern auf den Ankauf verschiedener Lebensmittel wie Salz angewiesen. Der herrschaftlichen Küche waren meist die extrem teuren, da aus fernen Ländern importierten Gewürze wie Pfeffer, Safran oder Zimt vorbehalten.
Der Obstgarten lieferte je nach Saison die unterschiedlichsten Früchte, wobei Zwetschgen, Kirschen, Schlehen, Äpfel, Quitten und Birnen breite Verwendung fanden. […] Auch das Beerenobst wie Blaubeeren, Erdbeeren, Brombeeren und Himbeeren wurden frisch konsumiert, während Weintrauben in der Regel in Form von Wein genossen wurden. Auf die gehobene Tafel kamen importierte Früchte wie Feigen, Datteln, Limonen oder Pomeranzen. Gesüßt wurde in der Regel mit Honig; der enorm teure Zucker blieb den kapitalkräftigen Schichten vorbehalten.
Seit etwa dem 16. Jahrhundert setzte sich der uns heute geläufige Dreierrhythmus in der Nahrungsaufnahme durch (Frühstück, Mittag- und Abendessen) und löste die mittelalterliche Zweimahlzeitenordnung (Morgen- und Nachtimbiss) ab. Dies bedeutete in der Regel ein relativ karges Frühstück, ein reichhaltiges Mittagessen um die zeitlich je nach Jahreszeit schwankende Tagesmitte herum – die Einführung eines einheitlichen und genormten 24-Stunden-Tages erfolgte erst im 19. Jahrhundert – und ein Abendessen. Oftmals wurde zwischen den Mahlzeiten Brot gegessen.
Reichhaltiger war das Nahrungsmittelangebot zu agrarischen Spitzenzeiten gemäß dem Grundsatz nach 2. Thess. 3,10: „Wer arbeitet, soll auch essen“. […]
Erst mit der […] nur zögerlich und punktuell einsetzenden Industrialisierung, mit den somit verbesserten Transportmöglichkeiten und Anbaumethoden änderten sich die Ernährungsgepflogenheiten langsam. Einen großen Einschnitt bildete etwa die Einführung und Durchsetzung der Kartoffel im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts, die rasch eine zentrale Rolle in der Lebensmittelversorgung einnahm.
„Schmalhans“ war in der Regel Küchenmeister. Mittelalterliche Skelettfunde dokumentieren in vielfältiger Weise die Folgen von Mangelernährung. Die Ernährungssituation vorindustrieller, vorwiegend agrarisch geprägter Gesellschaften war vom Ernteertrag abhängig.
Die sog. Kleine Eiszeit beeinträchtigte vom 14. bis 19. Jahrhundert den Anbau von Nahrungsmitteln phasenweise beträchtlich. Insbesondere das 14. Jahrhundert gilt aufgrund der sich verschlechternden klimatischen Bedingungen als Krisenjahrhundert. Aber auch das Spannungsverhältnis zwischen wachsender Bevölkerung und gleichbleibendem Ernteertrag hatte enormen Einfluss auf den Nahrungsmittelspielraum. Neben den vielen lokalen Hungerzeiten […] trafen die Hungerkrisen der 1570er und 1690er Jahre nahezu [ganz Süddeutschland].
Wie Wilhelm Abel (1904-1985) und Ernest Labrousse (1895-1988) nachweisen konnten, sank im 16. Jahrhundert die Kaufkraft aufgrund des stetigen Bevölkerungsanstiegs, mit dem die agrarische Produktion nicht mithalten konnte. In der Regel entschied das jeweilige Witterungsgeschehen, ob das nächste Jahr ein mageres oder fettes wurde. Die vielen Witterungsbeobachtungen durch Lostage (also Tage, die für das zukünftige Wettergeschehen als wichtig und prognostizierend empfunden wurden) und das flehentliche Bitten um das „täglich Brot“ sind Ergebnis der Erfahrungen des Hungers, die fast jede Generation machen musste. Nicht nur Witterungsunbilden wie ein zu nasses oder zu kaltes Frühjahr, zu trockene Sommer oder Hagelschauer, auch Verwüstungen durch adelige Treibjagden oder Kriege reduzierten die Ernteerträge. Die immer wiederkehrenden Hungerkrisen trafen vor allem jene Schichten existentiell, die mangels bebaubarem Grund und Boden auf den Zukauf von Nahrungsmittel angewiesen waren. Zyklische Hungerkrisen des „alten Typs“ (type ancien) – gekennzeichnet durch die „große Teuerung“ der Lebensmittel – gehörten bis Mitte des 19. Jahrhunderts zum Erfahrungshorizont der Menschen. Erst verbesserte Transport- und Anbaubedingungen verminderten das Auftreten von regionalen Hungerkrisen. Die letzten großen Hungerkrisen […] waren die aufgrund von Missernten ausgelösten (nahezu gesamteuropäischen) Hungerjahre 1771/72 und schließlich die im Gefolge der napoleonischen Kriege auftretende Hungersnot von 1817. Erhöhte Mortalitätsraten, das Anwachsen des Bettels und schließlich Hungerrevolten erforderten immer wieder obrigkeitliches Handeln und Fürsorgemaßnahmen, da Hunger auch zur Triebfeder revolutionärer Aktionen […] werden konnte.
Der kirchliche Kalender und die beiden großen Fastenzeiten vor den kirchlichen Hochfesten Weihnachten und Ostern strukturierten die Nahrungsgewohnheiten der gesamten Bevölkerung. Die Einhaltung der Fastengebote, insbesondere jene, die den Fleischkonsum betrafen, dürften für den überwiegenden Teil der Bevölkerung kein allzu großes Problem gewesen sein, da Fleisch wenn überhaupt nur an Festtagen auf den Tisch kam. Grundsätzlich fleischlos waren ungefähr 150 Tage im Jahr, nämlich der Freitag, der Samstag und in manchen Regionen auch der Mittwoch. Längere Abstinenz von fleischlichen Genüssen bedeuteten die vorösterliche 40-tägige Fastenzeit, die drei Bitttage vor Christi Himmelfahrt, die sog. vier Quatember und die Vorabende der großen Heiligenfeste. Vor den Fastenzeiten war es – soweit möglich – üblich, noch einmal über die Stränge zu schlagen, wie dies beispielsweise bei Fastnachtsfeiern und beim Reichen der Martinigans üblich war. Während der Fastenzeit wurde auf klösterlichen und adeligen Tafeln als Fleisch-Ersatz eine reichhaltige Auswahl an Fischen, Schnecken, Fröschen oder Bibern gereicht. Auch die exklusiven Mandeln und Reis galten in der Neuzeit als beliebte adelige Fastenspeisen. Viele religiöse Festtermine (z. B. St. Martin, St. Nikolaus) erinnerten die Begüterten an das Gebot der christlichen Nächstenliebe und mahnten zum Teilen.
Mehrere Heischetermine im Jahr – die meisten in der kalten, dunklen Jahreszeit wie etwa Allerseelen oder die Klöpfelnächte – boten den dörflichen und städtischen Unterschichten die Möglichkeit, durch sanktionierten Bettel ihren schmalen Speiseplan aufzubessern.
Im Zusammenhang mit dem kirchlichen Festkalender standen auch jahreszeitlich gebundene Speisen wie Ostereier, Fastenbrezen, Krapfen, Seelenzöpferl oder Gebildebrote wie Christstollen. Alle kirchlichen Hochfeste und auch Feste im individuellen Lebenslauf zeichneten sich aus durch üppige, fleischhaltige und fette Nahrung (z. B. Schmalznudeln). Das gemeinschaftliche Essen galt als zentraler Festbestandteil.
Ernährung eignete sich in besonderer Weise zur Demonstration des sozialen Status. Die Art und Weise der Nahrungsaufnahme – also wer welche Nahrungsmittel mit welcher kultureller Technik und in welchem sozialen Raum aß – erfüllte seit jeher nicht nur physiologisch-reproduktive Funktionen, sondern war hervorragend dazu geeignet, ständische Exklusivität zu demonstrieren. Vor allem das Essen in größerer Gemeinschaft diente nicht nur der Sättigung und der Deckung des täglichen Kalorienbedarfs, sondern war integraler Bestandteil adeligen Repräsentationsbedürfnisses. Insbesondere zu Festzeiten bogen sich die Tafeln, nicht zuletzt, um den sozialen Anspruch und die ökonomische Leistungskraft des Gastgebers drastisch deutlich zu machen. Insbesondere die raffinierte Art der Zubereitung und Würzung mit importierten Gewürzen, die Reichhaltigkeit und die Exklusivität entfaltete eine starke Barrierewirkung. Auch die Verfeinerung der Tischsitten als ein zentraler Aspekt im Prozess der Zivilisation war Ausdruck eines erfolgreichen sozialen Distanzierungsprozesses. Dem individuellen Essbereich mit eigenem Glas, Besteck und Teller im Rahmen der gehobenen Tafel stand die gemeinsam benutzte Schüssel der unteren Schichten gegenüber. Die ständischen Oberschichten verfügten zudem über Genussmittel wie besondere alkoholische Getränke und seit etwa dem späten 17. Jahrhundert über die extrem teuren und exklusiven Importwaren Kaffee, Tee, Tabak, Zucker und Schokolade. Alkohol wurde in Form von teuren ausländischen Weinen und Likören konsumiert, in der einfachen Bevölkerung zunächst in Form von Wein, dem aber das Bier seit dem 16. Jahrhundert den Rang ablief.
Während dem Hochadel zunehmend Probleme in Form der klassischen Zivilisationskrankheiten wie Gicht, Rheuma und Fettleibigkeit erwuchsen, produzierte die Ernährung der unteren Schichten Mangelkrankheiten und Phantasien vom Schlaraffenland, in dem einem die Würste in den Mund wuchsen und der süße Brei schier nie ausging.“[
Barbara Kink, Ernährung (Spätmittelalter/Frühe Neuzeit) https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Ern%C3%A4hrung_(Sp%C3%A4tmittelalter/Fr%C3%BChe_Neuzeit)#Quellen?action=history?action=history (10.02.2019)
Landwirtschaft in Hirschau
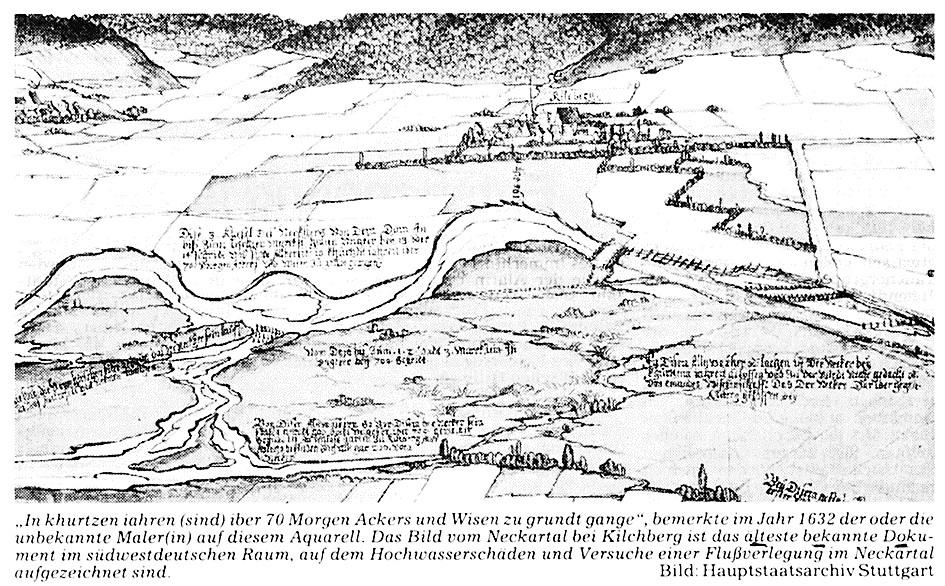
Hirschau war wie bereits erwähnt umgeben von Feldern, Wiesen, Wäldern und terrassenartig angelegten Weingärten, Gärten, „Holze“ und dem Neckar, der bei Hochwasser (1734, 1739, 1744, 1778, 1824, 1849, 1851, 1872 und 1880) zwischen Bühl und Hirschau über die Ufer trat und letztere oft erheblich beschädigte. „Unter samentlichen 236 3/4 J[auchert] Wiesen ist keine welche nicht dem wüttenden Neckarfluß der vüberschwemmung und hinwegreisung unterworfen und zwar solchergestalten, daß vielmalen nicht nur das Heu hinweggeflözet sondern das Graß dergestallten mit kis und wüst überschüttet wird und es vile Mühe und gelt kostet, solche wieder nutzbar herzustellen.“
Selbst wenn die Hirschauer die angerichteten Schäden sofort wieder ausbesserten, hatten die Überschwemmungen mehrjährige Ernteausfälle zur Folge – wirkliche Katastrophen.
Der Neckar bedrohte aber nicht nur regelmäßig Äcker und Wiesen, er setzte manchmal selbst das Dorf unter Wasser, was die Gemeinde zum Schuldenmachen zwang und die Bürger zu Frondiensten. Zeit und Geld fehlten dann auf den eigenen Feldern. Wiederholt überschwemmte also das Hochwasser Wiesen und Felder, und auch der Ort selbst wurde dadurch in Mitleidenschaft gezogen.
Zwischen Rottenburg und Tübingen waren früher keine Brücken vorhanden: Die auf dem rechten Neckarufer liegenden Wiesen und Felder erreichte man nur durch eine Furt (vor der man beim Kiesgraben Hufeisen von „völlistragern“ fand, denn man nutzte Maultiere (= Felleisenträger) zum Transport verschiedener Lasten; der Neckar bot vor allem Kies für den Hausbau). Der Fluss änderte häufig seinen Lauf und floss bald an Kiebingen und Bühl, bald näher an Hirschau vorbei, bis ihm durch den vorderösterreichischen „Robotabilizions Hoff Commissarij“, Landvogt und tatkräftigen Reformer Franz Anton Plank (auch: Blanc) zwischen 1779 und 1786 durch Grabung eines Kanals auf den Markungen Kiebingen, Bühl und Hirschau eine gerade Richtung gegeben wurde.
Als Robotabilizions Hoff Commissar war Plank auch für die Frondienste der Untertanen zuständig: Im ersten Teil des Wortes steckt das slawische robat für Frondienste, das althochdeutsche bill steht für Recht. Plank amtierte von 1778 bis 1787 in Rottenburg, wollte die Frondienste in Frucht- und Geldabgaben umwandeln und ließ in der ganzen Grafschaft Hohenberg Chausseen anlegen. Nach der Flußregulierung wurden 500 Morgen Feld, die vor dem Bau des neuen Flussbettes öde lagen, urbar gemacht.
Auf dem Neckar wurden auch Tannenlangholz und Schnittwaren geflößt – jährlich passierten 150 bis 200 Flöße das Gebiet. Als Gebühr für das zweitägige Anliegen eines Floßes am Hirschauer Neckarufer erhielten die Fischer vom Floßherrn zwei Bretter. Am 26. Oktober 1899 soll das letzte Floß Hirschau passiert haben.
Die in der Talsohle wie die auf dem Neckarkies liegenden Äcker wurden in Dreifelderwirtschaft bebaut. Das Getreide wurde meist mit der Sichel, später mit der Sense geschnitten (der Schnittlohn für einen Morgen betrug an Geld 3 Gulden, ½ Laib Brot und 1 Maß Wein oder Most) und mit dem Dreschflegel gedroschen.
Für die Hirschauer Bauern bestand der Zwang, ihr Getreide in der auf der linken Neckarseite befindlichen Distelmühle in Rottenburg oder in den beiden Rottenburger Stadtmühlen bzw. der Oberen Mühle mahlen zu lassen. Verfehlungen gegen diese Anordnungen wurden streng bestraft.
Zwar war in den Wäldern das Dürrholzlesen amtlich gestattet, artete aber zeitweilig bedenklich aus: mit Beil und Axt zogen die Leute aus und fällten nach Belieben Nadel- oder Laubholz. Daher wurden Verbote erlassen und spezielle „Holztäg“ angesetzt. Zur Gewinnung von Streulaub für die Viehställe waren besondere Laubtage angesetzt.
Auch ein Steinbruch wurde bei Hirschau betrieben
Bevölkerung
Im Jahr 1394 lebten 378 Menschen in Hirschau. Ob damals schon Haugs dort wohnten, ist nicht erwiesen, aber denkbar, denn die Steuerliste von 1394, die den Besitz jedes Steuernden einschließlich Hausrat in Pfund Heller und gleichzeitig Namen und Berufe mehrerer Einwohner angibt, nennt auch „Haintz Hug (60)“.
Auf die Steuerlisten aus dem späten 15. und frühen 16. Jahrhundert, die eine systematische, flächendeckende Steuererhebung belegen, folgten mehr oder weniger umfassende Herdstättenlisten. Für einzelne Orte finden sich die Steuerpflichtigen hier für ihre Häuser bzw. Herdstätten mit dem jeweiligen Steuerbetrag aufgelistet.
Besondere Anlässe bedingten gelegentlich eine außerordentliche Steuer: Die Türkengefahr beispielsweise führte zwischen 1542 und 1545 zu umfassenden Türkenschatzungen, einer Vermögenssteuer. Steuerlisten bieten mit den Namen der Steuerpflichtigen und deren Vermögensschätzung eine erste historische Bestandsaufnahme der Bevölkerung. Mit ihren repräsentativen Daten und Namen für die Haushaltsvorstände ermöglichen die Erhebungen als serielle Quellen verwaltungs- wie wirtschaftsgeschichtliche Auswertungen ebenso wie demographische Forschungen und sozialgeschichtliche Analysen. Vor allem sind sie wegen ihres frühen Namenmaterials von Familienforschern und Ortshistorikern gefragt.
Einer Steueraufnahme aus dem Jahr 1680, die die steuerpflichtigen Bauern und Handwerker, außerdem die Pferde- und Viehzahl sowie die Anzahl der Hofstätten nennt, kann man entnehmen, dass Hirschau damals 91 Steuerpflichtige in 70 Wohnungen (darunter 15 Witwen und Waisen, 1 Metzger, 1 Schneider, 3 Weber und 1 Küfer) sowie zwei leere Hofstätten im Dorf aufwies. Zu diesen Steuerpflichtigen gehörte auch mein 1654 geborener direkter Vorfahr Hans Georg Haug genannt Hans Jerg.
Meist waren die Handwerker im Ort arme Leute, ihre Kleidung wurde aus Flachs, Leinen oder Wolle und gegebenenfalls Leder gefertigt. Völlig mittellose Menschen trugen Lumpen.
Der Unterschied zwischen ganzen und halben Bauern ist nicht bekannt; die Pferdebesitzer werden „Bauern“, die anderen „Söldner“ genannt; so fallen unter die Abteilung „Bauern“ nur die zehn Besitzer der insgesamt 23 vorhandenen Pferde – die zu den fast täglich anfallenden Frondiensten benötigt wurden, denn die Untertanen aller hohenbergischen Dörfer mussten der Herrschaft „ungemessene und tägliche Frohn“ leisten, zu den herrschaftlichen Bauarbeiten alles Notwendige herbeischaffen und zudem noch von jedem Roß 10 Kreuzer, von jedem Tagelöhner 6 und von jeder Witwe 3 Kreuzer bezahlen. Die Gemeinde hatte neun Pflüge, die Viehzahl betrug 110 Kühe, 52 Schafe. An Schulden hatte die Gemeinde (inclusive der Privatleute) 4571 fl. 53 Kreuzer.
Steuern, Abgaben und Frondienste
Die Steuerzahlungen der Dorfbewohner standen den vorderösterreichischen Herren zu, ebenso generell Frevel (Bußen, die von der niederen Gerichtsbarkeit verhängt wurden, etwa nach Schlägereien oder anderen geringfügigen Anlässen) sowie das Fall- und Hauptrecht (also die Abgabe des besten Stück Viehs, die beim Tod eines Abhängigen fällig wurde).
Die Hirschauer Ortsuntertanen mussten an die Herrschaft Hohenberg den Heuzehnten abführen und noch verschiedene Hand- und Fuhrfronen ausführen (im Falle eines großen Heuvorrates waren die Kiebinger und Wurmlinger Bauern zu Hilfeleistungen verpflichtet). Im Jahr 1619 mussten die Hirschauer beispielsweise zehn Morgen Wiesen für die Hohenberger mähen und dörren (Hirschau und Wurmlingen mussten auch wechselweise 15 Morgen Wiesen im Burkenlehen (Burgalai) mähen und dörren).
Im Burgalai, einem ehemals waldigen Gebiet zwischen Wurmlingen und Kiebingen, war übrigens der Legende nach ein Geist beheimatet, der bei Einbruch der Dunkelheit unfolgsame Kinder in den Wald verschleppte, sie kräftig malträtierte und zudem sein Unwesen im Gebiet des Burgalai trieb. Dieser Geist wird uns im Zusammenhang mit meinem Urgroßvater Jakob Haug aus Wurmlingen noch begegnen.
Der Zehnte war eine Grund und Boden belastende Abgabe an die Kirche, ein Kloster oder einen weltlichen Herrn. Es bestand ein großer Zehnt (zu dem vor allem Wein, Roggen, Dinkel und Hafer gehörten), ein kleiner Zehnt (Erbsen, Linsen, Kraut und Rüben, aber auch Flachs und Hanf) und der Blutzehnt (der Zehnte von neugeborenen Tieren wie z.B. Ferkeln).
Zur Aufnahme der Zehntfrüchte diente die Hirschauer Zehntscheuer, in deren Innern sich vier Stockwerke für die Lagerung der Zehntfrüchte und eine kleine Stube für den Zehntknecht befanden.
Zur Erhebung des Zehnten bestellten die Zehntherren einen Zehntknecht, der z.B. beim Fruchtzehnten die Garben auf dem Feld vor dem Aufladen auf den Wagen auszuzählen hatte. Von allen Einkünften (Fruchtzehnt (Getreide), Heu- und Kleinzehnt) bis zu den Eiern mussten die Hirschauer Abgaben an die Landesherren entrichten, was der in Hirschau ansäßige Zehnt-Inspektor kontrollierte und überwachte. Steuern und Abgaben wurden aus dem Hohenbergischen an die österreichischen Stände zu Ehingen übergeben. Die Steuern und Abgaben wurden von den vorderösterreichischen Ständen, welche zu Ehingen zusammenkamen und wozu Städte und Ortschaften (z.B. Hirschau) der Grafschaft Hohenberg ihre Abgeordneten bestimmten, beraten und umgelegt.
Die Grafschaft Hohenberg galt bis ins 16. Jahrhundert gemeinhin als fruchtbar: „Die vilgemelte herrschaft Hohenberg hat ain ansehnlich schön und guet einkommen und sonderlich an wein, allerley getraidt und weisaten.“ (weisaten = Geschenk, Abgaben von Untergebenen)
Neben Wein wurde Dinkel, Roggen, etwas Weizen, besonders aber Gerste angebaut. Die Hirschauer lebten von der Landwirtschaft, von Weinbau (bereits im Jahr 1299 wird ein Weinberg „Costenzer“ erwähnt), Forstwirtschaf, Viehhaltung und Fischfang. Der fürstliche Fiskus vergab die Gewässer, Wälder und Mühlen als Lehen. Das Fischrecht (auch auf dem Neckar) hatten die Hohenberger inne, welches sie an Rottenburger Familien vergaben. Von 1445 bis 1715 hatte unter anderem auch die Rottenburger Familie Haug ein Fischwasser als Lehen.
In einem Fischwasserbrief aus dem Jahr 1667 wurde das Fischwasserlehen neben dem Schultheißen von Hirschau auch meinem direkten Vorfahren Hans Jerg Haug verliehen. Laut dem Lehensbrief musste er „allezeit gehorsamst seinen Zins zahlen“.
Die Bauernbefreiung (die Ablösung der persönlichen Fronen und Lasten sowie die Umwandlung des lehnpflichtigen bäuerlichen Besitzes in frei verfügbares Eigentum) war für die Bauern langfristig der wichtigste Schritt auf dem Weg zu einer Verbesserung der Lebensverhältnisse. Einen ersten Versuch dazu unternahm schon Maria Theresia und unter ihrem Sohn Joseph II. sollte Landvogt Franz Anton Blank 1784 den „Robot“ aufheben. Unter Robot versteht man Frondienste für die Herrschaft, für die die Fronpflichtigen 6 kr für den Mann und 3 kr für die Frau erhielten oder eine „Ergötzlichkeit“ in Form von Brot und Wein.
Doch Blank scheiterte: Obwohl in Hirschau, Wurmlingen und Hailfingen alle Fronpflichtigen einverstanden waren, verwarfen vier weitere Gemeinden den Vorschlag, vermutlich aus Misstrauen oder blindem Gehorsam gegen die frühere Obrigkeit. „Denn so albern ist der Bauer, daß er auch eine alte Last für eine alte Gerechtigkeit ansieht.“ Die Hirschauer gehörten nicht zu diesen „albernen Bauern“, und die anderen waren wohl nicht dumm, sondern nur aus Unerfahrenheit gegen den Reformer. Die persönliche Leibeigenschaft wurde erst 1817 in der sogenannten württembergischen „Bauernbefreiung“ aufgehoben, doch die vollständige Aufhebung der feudalen Lasten scheiterte zunächst am Widerstand der Zehntberechtigten, was als eine der Ursachen der Revolution 1848 anzusehen ist.
Das Ablösungsgesetz vom 14. April 1848 sah eine Entschädigung in 18facher Höhe des durchschnittlichen Jahresertrags vor, die Ablösungsschuld sollte in 16 Jahren getilgt werden.
In Hirschau waren die Zehntberechtigten die Staatsfinanzverwaltung, die Pfarrei Hirschau, Ignaz und Franz Gauger in Kiebingen, die Heiligenpflege Kiebingen, Joseph Friedrich und Wendelin Knobel in Hirschau, die Pfarrei Kilchberg, der Freiherr von Münch, Johann Heinrich Heckmann in Tübingen (Lamm) und die Universität Freiburg. Betroffen waren 69 Zehntpflichtige mit insgesamt 290 Morgen Land. Von dem Angebot machten 65 Hirschauer Gebrauch, zwei wollten lieber in Naturalien ablösen und zwei waren gegen die Ablösung.
Die Umwandlung des bäuerlichen Besitzes in frei verfügbares Eigentum und außerdem die Reformen in der Landwirtschaft gehörte zu den wichtigsten Voraussetzungen für die allmähliche Verbesserung der materiellen Lage der Dorfbevölkerung.
Mehrmals gab es in Hirschau, das in einer klimatischen Grenzzone lag, zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert große Missernten und gravierende Weinbergschäden durch tierische und pflanzliche Schädlinge, durch Kälte und Schnee, Frühjahrsfröste, Frühnebel und Wolkenbrüche, die für die Weingärtner wirtschaftlich von großem Nachteil waren, da der Weinbau für sie eine wichtige, manchmal sogar die einzige Einnahmequelle darstellte. Immer wieder bauten Wengerter mit den selbstbehauenen Steinen die Weinbergmauern mühsam wieder auf, wenn Schneeschmelze oder Wolkenbrüche dieselben einstürzen ließen.
Die überwiegende Zahl der Weinbaubetriebe war sehr klein und die Hirschauer Winzer gehörten wie die der umliegenden Dörfer meist den unteren Einkommensschichten an. Einen sehr schlechten Weinherbst gab es beispielsweise 1789. Während des strengen Winters 1788/89 erfroren eine Menge Reben, Obstbäume und selbst Waldbäume. Mehrere Gewitter brachten Hagel und Überschwemmungen des Neckars. Der Sommer war kühl und regnerisch, so dass Wein und Obst nicht gediehen. Die Schuld an den schlechten Weinjahren wurde auch dem schlechten Verhalten der Menschen oder der sittlichen Verwahrlosung zugeschrieben, denn Aberglaube war weit verbreitet. Selbst der heilige Urban, der Patron der Weingärtner, wurde von diesen als Schuldiger verdächtigt.
Die Hirschauer waren aber nicht nur vom den Alltag bestimmenden Wetter betroffen, sondern auch von politische Ereignissen wie dem Bauernkrieg: am 5. Mai 1525 schlug Truchseß Georg von Waldburg, der Bauernjörg genannte Feldherr des Schwäbischen Bundes, am Fuße des Wurmlinger Berges sein „veldleger Hirsee“ auf, da „das kriegsfolkh [den eiligen Zug vom Hegau nach Württemberg] des harten tags zuvor ser beklagt, die ryter nit beschlagen und die fusknecht kain geld gehapt und on das nit mer haben wellen ziehen“ – die Erholungspause war somit den meuternden Soldaten geschuldet, doch Hirschau und Wurmlingen wurden während der fünf Tage, in denen das Heer dort lagerte, „sehr geschädigt und verderbt“ und mussten nach Abzug desselben sogar noch die Brandschatzungen zahlen.
Auch die Glaubensspaltung (Reformation) und die Hexenverfolgungen betrafen Hirschau: „In Rottenburg am Neckar […] sind [zwischen 1596 und 1601] Hexen ([15 davon] aus Hirsau) […] zuerst enthauptet, danach verbrannt worden.“ Die Vorwürfe lauteten auf Viehzauber und Schaden an Menschen. Aufgrund von Worten, Wesen oder Verhalten verdächtigte, diffamierte und denunzierte Frauen hatten unter Verhaftung, Verhör, Verfemung und Folterqualen sowie psychischem Terror zu leiden (s.u.).
Der Dreißigjährige Krieg schließlich hinterließ ebenfalls Spuren in Hirschau: Am Spitzberg existieren noch Überreste der sogenannten Schwedenschanze, die an die Kampfhandlungen erinnert – der Berg ist hier mehrmals durchschnitten, einige Gräben sind noch sichtbar. Von hier aus sollen die Schweden die Wurmlinger Kapelle beschossen haben.
Hirschau wurde im Lauf des Krieges mehrfach geplündert: 1639 notierte der Pfarrer, dass kein Zehnter zu bekommen sei, „den man vor einem jahr wegen unsicherheit der soldaten nit hat könen ausseen“ – die Bauern hatten sich möglicherweise nicht auf die Felder getraut, einige hatten sich gar ins „unkatholische“ Tübingen geflüchtet und noch lange nach dem Krieg lagen Äcker und Weinberge brach. Der Schaden, den Hirschau im Dreißigjährigen Krieg erlitt, betrug 14.421 Gulden.
Ob manch Hirschauer in der Folge seine Heimat ebenso verließ wie etliche Gomaringer, weil er dort nicht mehr genug zum Leben fand oder ihn Hungersnöte in die Fremde trieb, muss noch erforscht werden. Manch ein Bewohner der Gegend jedenfalls versucht sein Glück offenbar im Elsass, wo nach dem Dreißigjährigen Krieg ganze Dörfer entvölkert waren und wo die Obrigkeit den Einwanderern Steuerfreiheit, Haus und Land versprach.
Die Pest
In Rottenburg wütete 1635 überdies die Pest und raffte auch einen großen Teil der Hirschauer Bevölkerung dahin: laut Totenregister starben an dieser Seuche zwischen 1635 und 1638 insgesamt 314 Einwohner. Auch in den folgenden Jahren starben noch weitere Hirschauer: 1635 (123), 1636 (45), 1637 (56) und 1638 (90). Allein die 123 Toten des Jahres 1635 machten in etwa ein Viertel der Einwohner aus.
Die übrigen Einwohner verließen größtenteils den Ort, um den Peinigungen der wilden Kriegsscharen zu entgehen. Es ist bezeichnend, dass im ganzen Jahr 1635 nur sieben Ehen geschlossen wurden. Weitere Kriege zwischen Österreich und Frankreich und schließlich die napoleonischen Kriege folgten.
Die schweren Kriegszeiten, Überschwemmungen und häufige Missernten steigerten das Elend vieler Einwohner, die – ebenso wie die Gemeinde als solche – „entsetzlich verschuldet“[ waren, und die wirtschaftliche Not ließ die armen Leute betteln. Für arme Dorfbewohner, die ihr Brennholz nicht kaufen konnten, wurden von der Gemeindeverwaltung Holzlesescheine ausgestellt und beim Metzelsuppenessen fertigte man extra sogenannte Bettelwürste für die Armen. Mittellosen Familien wurden kostenlos Wohnungen zur Verfügung gestellt – die erste soziale Einrichtung der Gemeinde war das zweistöckige Gemeindearmenhaus am Kreuzlinger Weg, in dem drei bis vier arme Familien untergebracht waren.
Noch im 16. Jahrhundert galt die Herrschaft Hohenberg als fruchtbare Grafschaft, die ihren Besitzern reiche Abgaben abwarf. Als Teil Vorderösterreichs entwickelten sich die Dörfer der Grafschaft nach 1600 aber kaum. Einer der Gründe für die Stagnation der einst blühenden Grafschaft war die schlechte Verkehrslage, die für Hirschau in seiner Randlage besonders ungünstig war. Die alten Verkehrswege von Rottenburg nach Tübingen und Stuttgart verliefen über Wurmlingen ins Ammertal oder rechts des Neckars. Um eine bessere Anbindung an den größeren Markt zu bekommen, schlossen Tübingen und Hirschau am 25. September 1514 einen Vertrag, „einen durchgenden understeinten farweg zu machen“: Die Straße führte direkt unter dem Spitzberg entlang und sollte das ganze Jahr befahrbar sein, hatte aber lediglich lokale Bedeutung. Ein „Rittweg”, 400 bis 500 Meter südlich vom Ortskern Hirschaus zum Fuß der Ödenburg ziehend, scheint bereits am Ende des Mittelalters vorübergehend eine Verbindung zwischen Rottenburg und Tübingen hergestellt zu haben.
Alle Wege wurden im übrigen zu Fuß zurückgelegt, selbst Strecken bis zu 20 km waren keine Seltenheit.
Eine Brücke über den Neckar zwischen Tübingen und Rottenburg gab es nicht, nur einen Steg und die Furt zu den Grundstücken auf der anderen Seite des Neckars. Der Weg nach Wurmlingen und Rottenburg war somit die wichtigste Verbindung nach außen.
Es gab auch keine einheitlichen Maße und Gewichte, was den Waren- und Wirtschaftsaustausch erschwerte.
Da also die wirtschaftliche Entwicklung Hirschaus an Hohenberg gebunden war, bedingte die Verschlechterung dessen wirtschaftlicher Lage auch die von Hirschau, und die Verkehrsverhältnisse verschlechterten sich durch den Bau der Straße von Stuttgart über Tübingen und Hechingen in die Schweiz im 18. Jahrhundert weiter.
Verwaltung
Im Ort gab es einen von der Obrigkeit eingesetzten Schultheißen, der einerseits die Herrschaft vertrat, andererseits Organ der Gemeinde war, und seit dem Spätmittelalter ein Ortsgericht. Mit dem Gemeinderat übte es die niedere Gerichtsbarkeit aus. 1820 gehörten dem Gemeinderat und Bürgerausschuss beispielsweise Valentin und Jakob Haug an.
Darüber hinaus gab es einen Nebenzoller und den oben erwähnten Zehnt-Inspektor. Gemeinderat und Bürgerschaft in Hirschau beschlossen jedes Jahr gemeinsam den Beginn der Traubenlese, den der Polizeidiener anschließend ausschellen und anschießen musste. Zwei von der Gemeinde bezahlte Wengertschützen bewachten die Weingärten. Während der Lese war mit dem sogenannten Scharwächter auch nachts eine Wache aufgestellt.
Viel Freude bereitete den jungen Hirschauern während der Lese offenbar das Schießen mit Pistolen in den Weingärten.
Die Zeit des Pressens der Trauben wurde unter den Weingärtnern verlost. Auch bei Nacht erfolgten die Vorbereitungen und das Pressen der Trauben. Ein Kelternknecht besorgte die Traubenpresse in der Kelter. Zu den letzten Kelternknechten gehörte unter anderem Matthäus Haug, der ein Neffe meines direkten Vorfahren Petrus Haug war.
Der Zehnt-Inspektor überwachte beispielsweise, dass der Wein sofort gekeltert und verkauft bzw. beim Feudalherrn gelagert wurde. Auswärtige Weinhändler, Wirte und Privatpersonen kauften den neuen Hirschauer Wein, der lange Zeit zu den besten in der Umgebung zählte. Während des Herbstes kamen auch viele Besucher nach Hirschau, um in den Wirtschaften den bekannten und beliebten Neuen Hirschauer zu verkosten.
Laut den vorderösterreichischen Regierungsakten begann man 1756/57 verschiedene Weingärten in Ackerland umzuwandeln. Dieselben lagen größtenteils am Fuße des Spitzberges. Viele Weingärten wurden als Obst-, Kraut- oder Gemüsegarten benützt, später wurden niedrigere Lagen auch mit Hopfen und Klee bepflanzt.
Bis Ende des 19. Jahrhunderts verdoppelte sich die Einwohnerzahl Hirschaus auf 843 im Jahr 1880. Mit dem Reichsdeputationshauptschluss und dem Preßburger Frieden von 1805, in dessen Folge es zu einer territorialen Revolution kam, musste Österreich die Grafschaft Hohenberg an das Herzogtum Württemberg abtreten; zwei Jahre später wurde das nun württembergische Hirschau dem Oberamt Rottenburg zugeordnet. 1806 kam Hirschau als Teil der Grafschaft Hohenberg von Vorderösterreich an das neu geschaffene, zuvor protestantische Königreich Württemberg. Dies war vom württembergischen König Friedrich mit der Teilnahme an den napoleonischen Kriegen teuer erkauft und traf vor allem die Neuwürttemberger hart, die vorher vom Militärdienst verschont waren. Rücksichtslos wurden nun Soldaten rekrutiert.
Als Herzog Friedrich II. am 1. Januar 1806 die Königswürde annahm bestanden die württembergischen Truppen nur aus drei Kavallerie-Regimentern, elf selbständigen Infanterie-Bataillonen und drei Artillerie-Kompanien sowie den kleinen Garde- und Garnisonseinheiten auf den Festungen und den Resten des Kapregiments in Asien. Die Mitgliedschaft im Rheinbund verpflichtete den König zur Stellung von 12.000 Mann. Die Teilnahme an den Napoleonischen Kriegen und den Befreiungskriegen erforderte immer wieder die Aufstellung neuer Truppenteile.
Die Rekrutierung der Mannschaften war geregelt durch das Militär-Conskriptions-Gesetz vom 6. August 1806 (mit vielen Ausnahmen) bzw. die Militär-Konskriptionsordnung vom 20. August 1809, die keine Ausnahmen mehr zuließ. Die Bataillone und Regimenter wurden zunächst weiter nach ihren Inhabern benannt. Durch eine Königliche Order vom 26. Mai 1811 trat an Stelle der Bezeichnung nach dem Regimentsinhaber eine durchgehende Nummerierung: „Alle Linien-Regimenter der Cavallerie und Infanterie, ausgenommen die, so Prinzen des Königl. Hauses zu Chefs haben, werden nicht mehr die Namen des Proprietairs führen, sondern nach Nummern folgendermaßen benannt werden.“
Die napoleonische Mediatisierung und ihre Auswirkungen auf Baden und Württemberg
Die Zukunft der Staaten Baden und Württemberg sowie der hohenzollerischen Fürstentümer war kurz vor dem Ausbruch der Französischen Revolution nicht vorherzusehen gewesen. Das politisch und territorial zersplitterte Gefüge des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation aus geistlichen Herrschaften, der Ritterschaft und den Reichsstädten, war seit geraumer Zeit von den Aufklärern kritisiert worden. Kleine und kleinste Territorien, wirtschaftliche Schwäche und altständische Elemente widersprachen dem modern aufklärerischen Geist. Aber erst nach der Französischen Revolution, den verlorenen Kriegen gegen das revolutionäre Frankreich und unter dem Druck Napoleons wurde das Heilige Römische Reich Deutscher Nation zerschlagen – es verschwand innerhalb weniger Jahre von der politischen Landkarte und wurde durch die beiden Flächenstaaten Baden und Württemberg sowie Hohenzollern ersetzt, das seine Weiterexistenz der napoleonischen Gunst verdankte. Eine geschickte Politik – der rechtzeitige Anschluss an (bzw. bei seiner sich abzeichnenden militärischen Niederlage der rechtzeitige Abfall von) Napoleon sicherte den Fürsten die Macht.
Zwischen 1800 und 1810 erzwang Napoleon durch den Reichsdeputationshauptschluss (1803), den Preßburger Frieden (1805) und die Rheinbundakte (1806) die Neuordnung Deutschlands, doch die französischen Ziele waren schon vorher deutlich geworden: Die von Frankreich besetzten deutschen linksrheinischen Gebiete sollten dauerhaft an Frankreich fallen und der Rhein als französische Ostgrenze festgeschrieben werden. Die deutschen Fürsten, die ihre Gebiete links des Rheins verloren (z.B. Württemberg) sollten mit Gebieten innerhalb des Reichs entschädigt werden. Dabei kam vor allem kirchlicher Besitz in Frage, den es zu säkularisieren galt, aber auch kleinere weltliche Gebiete – allen voran die Reichsstädte. Der Reichsdeputationshauptschluss fixierte dabei den ersten Schritt der territorialen Neuordnung Deutschlands, indem fast alle geistlichen Herrschaftsgebiete, 41 Reichsstädte und die rechtsrheinischen Gebiete der Kurpfalz unter den großen Territorialstaaten aufgeteilt wurden. Die alten Herrschaftsgebiete wurden säkularisiert bzw. mediatisiert, verloren also Besitz und Herrschaft. Baden und Württemberg profitierten bereits von diesem ersten Schritt in beträchtlichem Ausmaß: So erhielt Baden die Gebiete der bayerischen Kurpfalz mit Mannheim und Heidelberg, den territorialen Besitz des Bistums Konstanz sowie Teile der Bistümer Straßburg, Speyer und Basel. Große Gebietsteile der Reichsabteien, darunter Salem, sowie die Reichsstädte Offenburg, Gengenbach, Zell am Harmersbach, Überlingen oder Pfullendorf. Das der Fläche nach deutlich vergrößerte, aber noch immer territorial zersplitterte Baden wurde gleichzeitig zum Kurfürstentum erhoben.
Württemberg schnitt in dieser ersten Phase der territorialen Arrondierung bescheidener ab, erhielt aber als Kompensation für seine linksrheinischen Besitzungen ansehnliche geistliche Territorien wie Ellwangen, Zwiefalten und Schöntal. Zahlreiche Reichsstädte folgten: Aalen, Reutlingen, Weil der Stadt, Esslingen, Rottweil, Giengen, Heilbronn, Gmünd und Hall. Das große Gebiet der Reichsstadt Ulm, schon länger im Fokus der württembergischen Expansionsbestrebungen, fiel hingegen vorerst an Bayern. Wie Baden erlangte auch Württemberg den Stand eines Kurfürstentums. Beide Herrscher sicherten nun durch Allianzen mit Frankreich ihren neuen Besitzstand und konnten ihn sogar noch vergrößern. Mit dem Frieden von Preßburg (26. Dezember 1805) wurden die vorderösterreichischen Lande zwischen Baden, Württemberg und Bayern aufgeteilt.
Baden bekam den Breisgau und die Ortenau, die Stadt Konstanz sowie die Deutschordensgebiete um Mainau. Reichsritterschaftliche Gebiete der Kantone Kraichgau, Hegau-Allgäu-Bodensee und Odenwald sowie Gebiete des Fürstentums Fürstenberg und Villingen kamen hinzu.
Größer war nun der Zugewinn Württembergs das sich große Teile der vorderösterreichischen Ländermasse sicherte, darunter die Grafschaft Hohenberg und die fünf Donaustädte. Zahlreiche reichsritterschaftliche Territorien der Kantone Donau, Neckar-Schwarzwald, Kocher, Kraichgau und Teile Frankens ergänzten diesen territorialen Coup und gaben der Karte Württembergs eine erste geschlossene Kontur. Die mediatisierten reichsritterschaftlichen Gebiete verloren ihre Hoheitsrechte an den neuen Mittelstaat, nicht aber ihren Besitz. In einer Art Ringtausch mit Bayern ging schließlich Anfang 1806 das Fürstentum Ansbach mit Crailsheim an Bayern über, das sich zuvor mit Württemberg auf eine Grenzlinie geeinigt hatte. Auch Tettnang war 1805 bayerisch geworden und kam erst 1810 wieder an Württemberg zurück.
Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation war mit der Einbindung der südwestdeutschen Mittelstaaten in das Machtsystems Napoleons endgültig zerschlagen. 16 Reichsstände, da-runter Bayern, Baden, Württemberg und die hohenzollerischen Fürstentümer Hechingen und Sigmaringen, unterzeichneten am 1. August 1806 in Paris die Rheinbundakte und erklärten damit ihren förmlichen Austritt aus dem Alten Reich. Fünf Tage später legte Kaiser Franz II. die Kaiserkrone nieder. Das Reich war erloschen. Erneut wurden die Bündnispartner Napoleons belohnt. Mit dem Rheinbundvertrag wurde auch das Schicksal der kleineren weltlichen Territorien besiegelt. Die meisten der Fürsten, die wenige Jahre zuvor noch die Schutzlosigkeit ihrer geistlichen Nachbarterritorien ausgenutzt hatten, wurden nun selbst das Opfer mächtigerer Standesherren und mussten sich der Souveränität der Mittelstaaten unterordnen. Baden wurde zum Großherzogtum erhoben, Württemberg zum Königtum befördert und ergriff unter anderem die Herrschaft über die Besitzungen Waldburg. Zur weitergehenden territorialen Geschlossenheit trug die Übergabe Biberachs an Württemberg bei. Die beiden hohenzollerischen Fürstentümer, zuvor schon aus dem Fundus der benachbarten geistlichen Territorialsplitter abgefunden, sicherten sich in letzter Minute ihren Fortbestand durch eine strategische Heirat. Fürstin Amalie Zephyrine von Hohenzollern arrangierte den Ehebund des Erbprinzen Karl mit Antoinette Murat, einer Nichte von Napoleons Schwager. Auch die badische und die württembergische Dynastie untermauerten ihre Nähe zum napoleonischen Frankreich mit Eheschließungen: Der badische Erbprinz Karl heiratete Stéphanie de Beauharnais, eine Nichte der französischen Kaiserin Josephine. Katharina, die Tochter des württembergischen Königs Friedrich, heiratete Jérôme, den Bruder Napoleons und neuen König von Westfalen.
Einen abschließenden, wenn auch kleineren Arrondierungsschritt stellte nach den erfolgreichen französischen Kriegen gegen Preußen und Österreich der Schönbrunner Friede von 1809 dar, durch den die Reichsstädte Ravensburg, Leutkirch und der größte Teil des Ulmer Territoriums zu Württemberg kamen, das wiederum altwürttembergische Gebiete an Baden weiterreichte. Der französische Kaiser hatte den Deutschorden ganz aufgehoben und sein Gebiet im Tauberoberamt Württemberg zugeschlagen. Bayern wiederum musste als Kompensation für seine Gewinne im Osten alle Gebiete westlich der damals festgelegten und bis heute geltenden Landesgrenze um Crailsheim, Ulm und Tettnang an Württemberg abtreten.
Bis 1810 waren somit die Verschiebungen im Wesentlichen abgeschlossen. Sowohl für Baden als auch für Württemberg und die hohenzollerischen Lande war der territoriale Gesamtzusammenhang hergestellt. Bis auf kleinere Bereinigungen war damit der bis 1945 geltende Zustand erreicht.
In diesem skizzierten Länderschacher wuchs Württemberg nach Fläche und Einwohnern auf gut das Doppelte an und umfasste nun annähernd 20.000 km2 und etwa 1,4 Millionen Einwohner. Noch drastischer war der Zugewinn Badens, das sich der Fläche nach auf fast 15.000 km2 vervierfachte und der Einwohnerzahl nach auf rund eine Million versechsfachte. Die „Raubzüge“ dieser Jahre veränderten die Landkarte Südwestdeutschlands radikal. Gleichzeitig schufen sie die Voraussetzung für die Entwicklung von modernen Staaten. Beide Mittelstaaten standen mit der Modernisierung der Verwaltung, der Vereinheitlichung des Rechtssystems und der Mediatisierung vor gewaltigen Aufgaben. Beide orientierten sich am französischen Vorbild und schufen eine moderne Ministerialverwaltung in einem bürokratischen Zentralstaat. Für die alten wie für die neuen Untertanen bedeutete dies, dass sie dem Gewaltmonopol und den Steuerforderungen eines modernisierten und zentralisierten Staates unterworfen waren.
Nach Napoleons Niederlage in der Völkerschlacht bei Leipzig 1813 schloss sich Württemberg der antinapoleonischen Koalition an. So gelang es Friedrich I., sowohl die zwischen 1802 und 1810 erreichte Verdoppelung seines Territoriums auf rund 19.000km², als auch seine Souveränitätsrechte zu bewahren.
Das Königreich Württemberg hatte 1818 eine Einwohnerzahl von ca. 1,4 Mio. Bis 1852 nahm die Bevölkerung um 24 % auf über 1,7 Mio und bis 1900 um weitere 25 % auf etwa 2,2 Mio. zu. Zur Jahrhundertmitte lebt ein Viertel der Bevölkerung in Städten, drei Viertel auf dem Land.[
Das Oberamt Rottenburg …
… geht im Kern auf die 1381 von Habsburg erworbene Grafschaft Hohenberg zurück. Im Hauptort Rottenburg saß seit dem Spätmittelalter ein Vertreter des Landesherrn (zunächst Landeshauptmann, später Landvogt genannt). Dieses Amt war dreimal in Erbpacht vergeben: 1488 – 1606 an die Grafen von Zollern, 1616 – 1677 an die Freiherren von Hohenberg (die Nachkommen des Markgrafen Karl von Burgau) und 1702 – 1763 an die Freiherren von Ulm (Verpfändung). Personell wurde es im Rahmen der theresianischen Verwaltungsreform (1750) und endgültig 1763 (nach der Rückgabe an Habsburg) neu organisiert. Es bestand nunmehr aus dem Landvogt, drei Oberamtsräten und seit 1788 aus dem Schultheissen von Rottenburg, der von niederem Kanzleipersonal unterstützt wurde. 1750 wurde auch die geographische Zuständigkeit umfassend geregelt. Neben den hohenbergischen Kameralherrschaften wurden ihm nun sämtliche Dominien und die im Gebiet des oberen Neckar und der oberen Donau liegenden Adelsherrschaften unterstellt. Während in den Kameralherrschaften und Dominien die Landeshoheit Österreich eindeutig zustand, gab es bei den übrigen Herrschaften aber auch nach 1750 immer wieder Unklarkeiten und Streitigkeiten. Schließlich gab es auch Gebiete, bei denen das Oberamt nur Ansprüche anmeldete, die von der Gegenseite nicht anerkannt wurden. Der Sprengel des Oberamts blieb also bis zum Ende Vorderösterreichs trotz aller Bemühungen an den Grenzen zum Teil unscharf, auch wenn mehrere kaiserliche Verordnungen das Oberamt Rottenburg zur alleinigen Obrigkeit für alle zugehörigen Gebiete erklärten.
Am Ende des 18. Jahrhunderts waren dem Oberamt Rottenburg somit folgende Gebiete unterstellt: Kameralherrschaften (Stadt Rottenburg; Landschaft Niederhohenberg (Ergenzingen, Bühl, Dettingen, Hailfingen, Hirschau, Kiebingen mit Rohrhalden, Niedernau, Rohrdorf, Schwalldorf, Seebronn, Weiler, Weitingen, Wendelsheim, Wurmlingen, 1/2 Altingen (Kondominat mit Württemberg)); Obervogteiamt Horb (Horb, Altheim, Grünmettstetten, Heiligenbronn, Ihlingen, Salzstetten, Bildechingen, Eutingen, Buchhof); Obervogteiamt Oberndorf (Oberndorf, Burg Waseneck, Altoberndorf, Beffendorf, Bochingen, Waldmössingen); Obervogteiamt Spaichingen (Fridingen, Spaichingen, Bubsheim, Dautmergen, Deilingen, Delkhofen, Hohenberg (Burgruine und Hofgut), Denkingen, Dürbheim, Egesheim, Gosheim, Ratshausen, Reichenbach, Schörzingen, Neuhaus, Wehingen, Weilen unter den Rinnen, Bärental (Bergwerksverwaltung)); Stadtschultheissenamt Schömberg; Justizbeamtung Binsdorf), Dominien (Herrschaft Schramberg; Herrschaften Werenwag und Kallenberg; Frommenhausen; Obernau mit Lützenhardt; Nordstetten mit Isenburg; Gunningen) und Standesherrschaften (Herrschaft Wehrstein; Herrschaft Stetten am kalten Markt; Herrschaft Oberhausen; Herrschaft Dotternhausen; Hirrlingen; Ober- und Untertalheim; 2/3 Oberndorf und Poltringen). Hinzu kamen eine ganze Reihe weiterer einzelner – teilweise umstrittener – Rechte in 47 verschiedenen Orten.
Das Oberamt hatte in allen Verwaltungs-, Justiz- und Finanzangelegenheiten umfassende Zuständigkeiten. Es empfing von den nachgeordneten Dienststellen sämtliche Berichte, nahm dort Visitationen vor, bildete das Kriminalgericht und die niedrige Gerichtsbehörde, war Wirtschaftsamt und Steuereinzugsstelle. Während in den Dominien und in den Standesherrschaften in der Regel adelige Familien wesentliche Teile der Herrschaft ausübten – am Ende des 18. Jahrhunderts waren dies etwa für die Herrschaft Schramberg die Grafen von Bissingen, für Werenwag und Kallenberg die Freiherren von Ulm zu Erbach, für Obernau mit Lützenhardt die Freiherren von Raßler, für Nordstetten mit Isenburg die Keller von Schleitheim, für die Herrschaft Wehrstein die Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen, für Oberhausen mit Hausen am Tann die Herren von Pach, für Ober- und Untertalheim die Kechler von Schwandorf und für Teile von Oberndorf und Poltringen wieder die Freiherren von Ulm, jeweils als österreichische Vasallen, die Herrschaften Dotternhausen und Hirrlingen waren adelige Allodialgüter –, bestehen die Kameralherrschaften im wesentlichen aus den alten Grafschaften Ober- und Niederhohenberg.
[Deren Herrschaftsbildung begannn im Gebiet zwischen Schömberg und Spaichingen um den Oberhohenberg im 12. Jahrhundert. Hier lag die Stammburg der Grafen von Hohenberg, einer Seitenlinie der Grafen von Zollern. Im 13. Jahrhundert verschon sich dann nach dem Erwerb der Grafschaft Haigerloch und des Gebiets um Rottenburg, wo bisher lokale Adelsgeschlechter, etwa die Herren von Rottenburg, begütert waren, der Schwerpunktder Grafschaft an den mittleren Neckar. Graf Burkart (1237 – 1253) stiftete dort in Kirchberg bei Sulz ein Nonnenkloster, das, 1245 dem Dominikanerorden unterstellt, zum Hauskloster der Hohenberger wurde. Durch seine Heirat mit der Erbtochter Mechthild des Pfalzgrafen Rudolf II. von Tübingen erhielt er einen Teil der Herrschaft Nagold und konnte so sein Territorium erheblich nach Nordwesten erweitern. Durch Heirat kam auch die pfalzgräfliche Stadt Horb mit Umgebung dazu. Das 14. Jahrhundert sieht die Hohenberger schließlich meist an der Seite der Habsburger, die die Grafschaft bald als einen Vorposten in Südwestdeutschland betrachteten. So war es nicht zuletzt diese enge Beziehung, die Graf Rudolf von Hohenberg (1338 – 1389) veranlasste, die gesamte Grafschaft 1381 an Herzog Leopold von Österreich zu verkaufen. Bald darauf starben die Hohenberger aus. Nach mehreren Verpfändungen gelangte die Grafschaft 1458 an Herzog Sigmund von Tirol, der sie 1490 an König Maximilian abtrat, der seinerseits schon wenige Jahre später die Grafschaft Haigerloch im Tausch gegen die Herrschaft Rhäzüns in Graubünden an die Grafen von Zollern weiterreichte. 1522 im Besitz Karls V., trat dieser Hohenberg an seinen Bruder Ferdinand ab, der sie 1554 an seinen Sohn vererbte. 1606 – 1618 war die Grafschaft als österreichisches Afterlehen im Besitz des Sohns Ferdinands und der Philippine Welser, des Markgrafen Karl von Burgau. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde die Grafschaft noch einmal an die Freiherren von Ulm zu Erbach verpfändet, die 1722 auf sie verzichteten und dafür im Gegenzug die Herrschaften Werenwag, Kallenberg, Oberdorf und Poltringen erhielten. Der territoriale Bestand Hohenbergs hielt sich nunmehr im Großen und Ganzen bis zum Ende des alten Reichs.
Auswirkungen der Zugehörigkeit zum Oberamt Rottenburg auf lokaler Ebene
Die Oberämter hatten neben ihren im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung selbst definierten Aufgaben auch vom Land übertragene Staatsaufgaben wahrzunehmen. Sie übernahmen außerdem freiwillig gesetzliche Verpflichtungen der Gemeinden, wie zum Beispiel die Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen. Organe des Oberamts waren der Oberamtmann und die Amtsversammlung, in der sämtliche Gemeinden des Oberamts vertreten waren. Sie trat jährlich ein- bis zweimal zusammen. Die laufenden Geschäfte erledigte der Amtsversammlungsausschuss, der einen Aktuar als Vorsitzenden und gleichzeitig Stellvertreter des Oberamtmanns bestellte. Als Kassenverwalter wurde ein Oberamtspfleger bestellt, der Sitz und beratende Stimme in der Amtsversammlung hatte.
Die Rechte einer Gemeinde wurden nun durch einen gewählten Gemeinderat ausgeübt. Jede Gemeinde erhielt einen Vorstand (Schultheißen), der für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und die Durchführung der Gesetze zuständig war und außerdem die Verwaltung der Gemeindeangelegenheit zu leiten und zu beaufsichtigen hatte. Neben dem Schultheißen musste es einen Ratsschreiber geben, der alle „Schreiberei-Geschäfte“ zu besorgen hatte und wie der Ortsvorsteher auf Lebenszeit gewählt wurde. Für das Rechnungswesen und die Verwaltung des Gemeindevermögens wurden aus der Mitte des Gemeinderats einer oder zwei Räte gewählt. Das Vertretungsorgan der Bürgerschaft war der Bürger-Ausschuss, dessen Mitglieder zunächst auf zwei, später vier Jahre gewählt wurden und im Wesentlichen nur eine Kontrollfunktion, aber keine Entscheidungsbefugnis hatten. Seine Zustimmung war jedoch notwendig bei der Aufstellung des Gemeindehaushalts und bei unvorhergesehenen Ausgaben. Das Wahlrecht war aber nicht geheim, die Stimmzettel wurden offen abgegeben und der Name des Wählers war vermerkt. Bei der Wahl des Schultheißen mussten die Bürger auf dem Rathaus einen Stimmzettel mit drei Namen offen abgeben. Bei der Hirschauer Schultheißenwahl von 1851 erhielten 50 Personen wenigstens eine Stimme: von den 476 Stimmen der 169 Wähler erhielt Gottfried Haug 80 Stimmen. Bisher liegen mir keine Erkenntnisse bezüglich eines etwaigen Verwandtschaftsverhältnisses vor. Gottfried Haug war verheiratet mit Afra Knobel und hatte mindestens einen Sohn, Johann Georg.
Da er aber „im Schreiben, Lesen u. Rechnen schwach“ war, ernannte die Kreisregierung Peter Friedrich, der nur 57 Stimmen erhalten hatte, aber „im Lesen, Schreiben u. Rechnen wohl erfahren“ war. Bei dieser Art von Wahl konnten die Wähler also nicht den Mann wählen, den sie wirklich wollten und so konnte auch kein Kandidat wirklich die Mehrheit der Wähler für sich gewinnen. Erst nach der Änderung des Wahlrechts ergab sich eine klare Mehrheitsentscheidung: 1905 stimmten von 152 Wahlberechtigten 129 Bürger ab – fast 85 % der Wahlberechtigten – und 119 von ihnen wählten den Steinhauer Markus Haug. Auch zu ihm gibt es bisher keine Hinweise auf eine Verwandtschaft.
Die Rechtsstellung der Bürger in der Gemeinde wurde seit 1806 durch die Staats- und die Gemeindeangehörigkeit geregelt, die jeder Württemberger besitzen musste und deren Erwerb (ebenso wie die Rechte und Pflichten) in den Gesetzen von 1828 und 1833 geregelt wurden. Es gab Bürger, Beisitzer und bloße Einwohner. Wer das Bürgerrecht einer anderen Gemeinde besaß, konnte sich niederlassen, ohne das Bürgerrecht zu erwerben, er musste dann Wohnsteuer bezahlen. Die Gemeindeangehörigkeit wurde durch Geburt, Aufnahme oder Zuteilung erworben. Auch ein schon lange Ansässiger konnte Bürger einer anderen Gemeinde sein und war dann eben nicht „hiesig“.
Für die Aufnahme waren der Nachweis ausreichender Einkünfte und die Bezahlung einer Aufnahmegebühr notwendig, die für Hirschau auf 70 Gulden für einen Mann, 35 Gulden für eine Frau, 10 Gulden für ein männliches, 5 für ein weibliches Kind festgesetzt wurde. Bürger oder Beisitzer besaßen auch das Heimatrecht ihrer Gemeinde: sie durften sich niederlassen und ein Gewerbe betreiben. Am wichtigsten war der Anspruch auf Unterstützung im Falle der Bedürftigkeit.
„Heimat“ hatte also eine wichtige rechtliche Bedeutung und entsprach einer Art Sozialversicherung, denn die „Heimatgemeinde“, nicht der Wohnort war zuständig für Sozialfälle.
Das Wahlrecht und das Recht zur Teilhabe an den Gemeinde-Nutzungen besaß nur der Bürger. Wegen dem Recht auf Unterstützung und dem Anteil an den Gemeindenutzungen verlangten reiche Gemeinden eine hohe Aufnahmegebühr, sie wollten den Zuzug armer Menschen verhindern. Dagegen war für Gemeinden der vierten Klasse wie Hirschau kein besonderer Vermögensnachweis notwendig.
Für Pfarrer und Staatsbeamte gab es eine Ausnahmeregelung, die von der Verfassung garantiert wurde. Da es im Ort keine Beamten gab, betraf das in Hirschau nur den Pfarrer.
Schon früher hatte es gelegentlich Auseinandersetzung darüber gegeben, ob der Pfarrer Gemeindebürger mit allen Rechten und Pflichten sei. Die Hirschauer waren der Meinung, dass der Pfarrer, wenn er die Rechte eines Gemeindebürgers in Anspruch nehmen wollte, auch Fronpflichten zu leisten und Bürgersteuer zu zahlen hatte. Tatsächlich wurde 1695 im Streit Hirschaus mit Kreuzlingen von Hirschau zugesichert, dass der Pfarrer die „bürgerlichen gerechtsame“ erhalten solle „gleich einem Mitbürger“. Erst durch das Gesetz von 1828 wurden solche Privilegien aufgehoben und ein wichtiger Schritt zu einem gleichen Staatsbürgerrecht gemacht.
Gemeindefinanzen
Die Ausgaben wurden aus dem Gemeindevermögen und einer Umlage, dem „Communschaden“ bestritten, der nach den allgemeinen Steuervorschriften auf die Bürger umgelegt wurde. Was Gemeinderat und Bürgerausschuss beschlossen, wurde also direkt von den Bürgern bezahlt, die es sofort zu spüren bekamen, wenn auf dem Rathaus neue Ausgaben beschlossen wurden. Kein Wunder taten sich die Mitglieder von Gemeinderat und Bürgerausschuss bei der Bewilligung von Ausgaben für kommunale Einrichtungen schwer. Das Interesse am Sparen war dadurch groß.
Reiche Gemeinden konnten ihre Ausgaben zu einem Großteil aus dem eigenen Vermögen bestreiten, die Bürger hatten also materielle Vorteile davon, wenn sie einer reichen Gemeinde angehörten. Die Angaben über den Gemeindebesitz und den Gemeindehaushalt sind in Hirschau sehr unbestimmt und zufällig, obwohl die Gemeindeordnung nun für jedes Jahr die Festlegung eines Haushalts und eine ordentliche Haushaltsführung verlangte.
Die von Württemberg 1806 eingesetzte Zentralorganisationskommission führte für jedes Dorf eine Bestandsaufnahme durch, wobei die neue Gemeindeverfassung, die das Element der Wahl für den Schultheiß einführte, am wichtigsten war. Hirschau zählte nach dieser Auflistung 596 Einwohner, darunter 108 Bürger und acht Wittfrauen. Dem neuen Schultheiß Johann Georg Schnitzler standen sechs Deputierte zur Seite, die im Wesentlichen die Steuern einzuziehen hatten. Für Grenzfragen gab es den „Felduntergang“: 1 Hauptmann und 5 Feldrichter mussten die Grenzstreitigkeiten regeln. Außerdem gab es Feuerschauer, Viehschauer, 2 Nachtwächter, Feldschützen, Weinbergschützen, Kuh- und Schafhirten, Kelternwächter (in der Zeit der Weinlese), Weidemeister, den für die Eichung zuständigen Pferchmeister, den Mesner (der zugleich Lehrer war), 1 Hebamme und 1 Wochenweib, 1 Maulwurffänger und 1 Baumeister, der aber unter der Aufsicht des Bürgermeisters stand.
Für diese Nebenämter gab es eine Entschädigung. Im Jahr sollten erhalten: der Schultheiß 40 Gulden, der Bürgermeister [Kämmerer] 24, der zweite Bürgermeister acht, jedes weitere Magistratsmitglied zwei und der Pferchmeister acht. Der Lehrer bekam von der Gemeinde 60 Gulden und als Mesner 8 Mater Dinkel (was zum Zeitpunkt der Festlegung 44 Gulden entsprach). Außerdem bekam er von jedem Kommunikanten und bei jedem Sterbefall Brotgaben und hatte Einkünfte aus der eigenen Landwirtschaft.
Die vergleichbaren Zahlen, auch die für die Bürgeraufnahme, lagen im benachbarten Wurmlingen etwas höher, auch das ist ein starker Hinweis darauf, dass Hirschau zu den ärmeren Gemeinden im Oberamt zählte, in der unordentliches Verhalten (Unsittlichkeit, Trunksucht, schlechtes Haushalten) strafbare Handlungen waren. Doch trennten sich die Bereiche Recht und Moral nun zunehmend, und auch die Kirche musste sich auf das Mahnen beschränken. 1822 kritisierte der katholische Kirchenrat in Stuttgart das gesetzwidrige Verweilen in den Wirtshäusern sowie das Umherschwärmen auf der Gasse, weil dadurch Rohheit und Ausschweifung entstehe. Die Kirche müsse solchem Verhalten Schranken setzen und dürfe auch das Kaufen und Verkaufen am Sonntag nicht dulden.
So wurde 1824 die steigende Schamlosigkeit bemängelt und die dadurch bewirkte Zunahme der unehelich geborenen Kinder. 1830 hatte sich dieses Problem noch vergrößert. Es gebe noch Lichtstuben, aber keine „Privathäuser der Versuchung“. Der Zustand der Gemeinde sei nicht gut, „aber auch nicht ganz böse zu nennen“.
Es war Brauch, lange Winterabende gemeinsam mit geselligen Handarbeiten in Licht- oder Spinnstuben zu verbringen, die in den Wintermonaten Treffpunkte der unverheirateten Frauen waren: Üblicherweise traf sich ein Mädchenjahrgang, um für seine Aussteuer zu spinnen und andere Handarbeiten zu verrichten. Die gemeinsame Arbeit diente nicht nur der Geselligkeit; auf diese Weise konnte sowohl das noch nicht elektrisch verfügbare Licht in Form von Kienspänen, Kerzen oder Öllampen wie auch Heiz- und Feuerholz durch die gemeinschaftliche Nutzung gespart werden. Junge Männer trafen sich, so lange sie noch zu jung waren, um eine Wirtschaft zu besuchen, getrennt von den Mädchen, allerdings war es vielfach üblich, dass die Burschen die Mädchen am Ende des Abends besuchten und nach Hause begleiteten. Das war eine der wenigen Gelegenheiten, halbwegs unbeobachtet eine Beziehung anzubahnen. In der Folge galten Spinnstuben bei weltlicher wie geistlicher Obrigkeit als Orte sexueller Ausschweifung: so gab es ab dem 16. Jahrhundert von katholischer wie evangelischer Seite Bestrebungen, die Lichtstuben zu verbieten; teilweise wurden die dort zum Tanz aufspielenden Musiker verhaftet, da die Zusammenkünfte auch zum unabhängigen Nachrichtenaustausch dienen mochten. Die Kontrolle wurde teilweise durch die Installation eines Lichtherrn gewährleistet, welcher der geistlichen Obrigkeit verantwortlich war. Doch im Jahr 1825 wäre der Hirschauer Schultheiß Binder beinahe erschossen worden, weil er versucht hatte, den Nachtschwärmern Einhalt zu gebieten.
Als einer der Gründe für die schlechten Sitten wurde die Gleichgültigkeit der Eltern vermutet. Beklagt wurde als größte Ausschweifung das nächtliche Herumschwärmen der Jugendlichen. 1842 hatte die Zahl der unehelich geborenen Kinder wieder zugenommen und den Hirschauern wurde allerhand vorgeworfen: Trunksucht und Abhalten von Saufgelagen, Wohlleben und Unzucht, Streit und Widerspenstigkeit. Die Hoffnung auf ein Ende der kriegerischen Zeit erfüllte sich indes nach 1806 noch nicht. Da Hohenberg württembergisch geworden war, wurden die Hirschauer noch stärker in kriegerischen Ereignisse einbezogen als zuvor: Der württembergische Herzog wurde durch Napoleon zum Kurfürst erhoben und schließlich sogar König, sein Land wurde durch die Säkularisation geistlicher und die Eingliederung weltlicher Territorien mehr als doppelt so groß. Das hatte seinen Preis: Soldaten. Auch zwei junge Männer aus meiner Familie, die Brüder Joseph und Franz Saless Haug, wurden rekrutiert. Näheres dazu folgt an anderer Stelle.
Auch in vorderösterreichischer Herrschaft hatte es eine Militärpflicht gegeben, doch die Untertanen waren nicht gewohnt, wirklich Soldat werden zu müssen. Das änderte sich nun, denn der neue württembergische König machte Ernst mit der Militärpflicht seiner Untertanen, die er schon drei Monate nach dem Herrschaftswechsel am 6. August 1806 einführte. Als Napoleon den Feldzug gegen Russland vorbereitete, musste der König 15.800 Mann stellen (von denen nur 300 Mann überleben sollten).
Ausgewählte Familienmitglieder
Beginnen möchte ich nun mit dem ersten direkten Vorfahren, den ich in Hirschauer Kirchenbüchern gefunden habe. Nach und nach werde ich versuchen, weitere Familienmitglieder vorzustellen. Teilweise habe ich in den Archiven erstaunliche Ergebnisse zutage gefördert, häufig ist die Quellenlage aber dürftig und außer den Lebensdaten der Menschen nicht viel über sie bekannt.
Hans Georg Haug (* um 1620 – 1680) und Maria Wohlschießin († 1651)
Der erste nachweisbare direkte Vorfahr Hans Georg Haug wurde um 1620 in Hirschau geboren. Da die erhaltenen Taufbücher des Ortes erst mit dem Jahr 1648 einsetzen, konnten bislang weder sein genaues Geburts- bzw. Taufdatum, noch die Namen seiner Eltern oder Geschwister ermittelt werden. Es ist daher ungewiss, ob der am Freitag, den 30. Januar 1635 verstorbene Hans Jerg Haug, oder Johannes Haug, der am 18. Februar (Mittwoch) desselben? Jahres verstarb, Vater oder Onkel des Hans Georg Haug waren. Da die Familie Haug aber aus mehreren Zweigen bestand, die ab 1635 parallel in den Eheregistern auftauchen, ist anzunehmen, dass mein Vorfahr mehrere Geschwister hatte. Über seine Kindheit und Jugend ist bislang nichts bekannt.
Dem Hirschauer Eheregister ab 1635 kann man entnehmen, dass Hans Georg Haug von der Familie bzw. im Ort Jerg genannt wurde und am Donnerstag, den 23. November 1637 als Trauzeuge von „Hans Wohlschieß genannt Zimmermann & Maria Kaltenmark“ in Erscheinung trat.
Im Herbst des darauffolgenden Jahres heiratete Jerg zum ersten Mal selbst – insgesamt war er zweimal verheiratet und hatte vier Kinder.
Hans Jergs erste Trauung am 27. Januar 1638 fand an einem Samstag in der Hirschauer Dorfkirche St. Ägidius statt. Möglicherweise war Hans Jergs Braut Maria Wohlschießin eine Schwester des o.g. Hans Wohlschieß, bei dem der Bräutigam zwei Monate zuvor Trauzeuge gewesen war. Jergs eigener Trauzeuge war ein F. Jacob Gillmann.
Auffällig ist die in diesem Jahrzehnt geringe Zahl der Hochzeiten in Hirschau. So gab es 1635 sieben Trauungen, 1636 zehn Trauungen, 1637 sechs und 1638 bzw. 1639 jeweils nur drei Trauungen. Im Jahr 1640 fand gar nur eine Trauung statt, 1641 wieder drei, was in erster Linie mit den Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges, möglicherweise einer Hungersnot oder auch der Pest zusammenhing.
In den folgenden Jahren war Jerg Haug erneut Trauzeuge, zunächst am Mittwoch, den 20. September 1648 bei Aegidius Ehni und Maria Koslerin, am 5. Februar 1649 (Montag) bei Andreas Schall und Anna NN, sowie am Sonntag, den 19. Mai 1650 – als „Joannes Georgius Haug“ im Kirchenbuch verzeichnet – bei der Hochzeit von Iulius Mayer und Maria NN aus Rottenburg. Am 5. Februar 1652, einem Donnerstag, war „Joannes Georgius Haug“ Trauzeuge bei der Hochzeit von Christian Stromayer und Anna Schaiblerin, ebenso am 11. Mai 1653 (Mittwoch) bei der Hochzeit von Johannes Knöpfler und Magdalena NN.
Maria Wohlschießin starb dreizehn Jahre nach der Hochzeit am Dienstag, den 28. März 1651 in Hirschau. Jerg und Maria bekamen offenbar keine Kinder. Der Witwer heiratete danach erneut und wurde nun bald zum ersten Mal Vater.
Hans Georg Haug (* um 1620 – 1680) und Anna Staigerin
In zweiter Ehe war Jerg Haug nach dem Tod seiner ersten Frau Maria Wohlschießin mit der Hirschauerin Anna Staigerin verheiratet. Mitte des 17. Jahrhunderts in Hirschau lebend, bekamen sie mindestens vier Kinder:
- Anna Haug (* Anfang Juni 1652 in Hirschau; ~ 5. Juni 1652 (Samstag); Paten: Hans Küttel und Agatha Klotz); Anna verstarb am Donnerstag, den 27. Februar 1721.
- Johannes Georgius (Hans/Hans Jerg) Haug (Ioannes Georgius; im Juni 1654 als „eheliches Kind“ in Hirschau geboren; ~ am Samstag, den 17. Juni 1654; Paten: Hans Küttel und Agatha Klotz)
- Agnes Haug (~ 10. Januar 1656; Paten: Hans Kittel, Agatha Kemmerer); Agnes starb am Mittwoch, den 18. November 1705.
- Georg Haug (* Ende April 1659; ~ am Mittwoch, den 27. April 1659; Paten: Johannes Küttel und Agatha Kemmerer).;Georg starb am Samstag, den 30. Dezember 1713.
Hans Jerg Haug, nun selbst Vater von vier Kindern, wird am 13. November 1648 (Montag) als Pate von Christina … (unleserlich), am 14. Januar 1651 (Dienstag) als Pate von Johannes … (unleserlich), am Sonntag, den 5. September 1652 als Pate von Conrad Ruf, am 29. November 1652 (Montag) als Pate von Andreas Stayger, am 22. August 1653 (Montag) als Pate von Anna Maria Staiger, am 30. November 1654 (Donnerstag) als Pate von Catharina Kopp, am 20. Januar 1655 (Samstag) als Pate von Maria Mayer, am 6. Juni 1655 (Mittwoch) als Pate von Maria Magdalena Kösler, am 3. November 1655 (Samstag) als Pate von Catharina Staiger, im Februar 1657 als Pate von Martha Raaff, im September 1657 als Pate von Magdalena Staiger, am 23. Mai 1658 (Sonntag) als Pate von Anna … Raaff, am 29. März 1659 (Dienstag) als Pate von Josephus Mayer, am 9. September 1660 (Sonntag) als Pate von Maria Kessler, am 18. Dezember 1660 (Dienstag) als Pate von Johannes Jacobus Staiger, am 29. Dezember 1660 (Samstag) als Pate von Fidelius Raffer und am Donnerstag, den 10. Oktober 1661 als Pate von Johannes Fridericus Raff genannt. Alle diese Patenkinder des Hans Jerg Haug wurden ehelich geboren und sind im Hirschauer Taufbuch Bd. I verzeichnet.
Hans Georg Haug starb am Dienstag, den 20. Januar 1680 in Hirschau im Alter von etwas mehr als 60 Jahren.
Er hatte eventuell noch zwei weitere Söhne (Martin und Nicolaus Haug) und/oder einen Bruder (oder Cousin) namens Nicolaus Haug sowie einen Bruder (oder Cousin) namens Petrus Haug. Dies muss noch erforscht werden. Die Lebensdaten seiner zweiten Ehefrau sind bislang ebenfalls noch unerforscht.
Hans Jerg Haugs zweites Kind, der im Frühsommer 1654 geborene und nach ihm benannte Sohn Johannes Georgius, ist mein direker Vorfahre.
Johannes Georg Haug (1654 – 1713) und Christina Greterin (1668 – 1707)
Im Kirchenbuch wird der älteste Sohn von Hans Georg Haug und Anna Staigerin mehrfach „Jung Hans Jörg“ genannt. Über den Beruf des immer wieder auch Hans bzw. Hans Jerg genannten Mannes ist bisher nichts bekannt. Er war zweimal verheiratet und hatte insgesamt elf Kinder.
Im Copulationsbuch wird er aus Anlass seiner ersten Eheschließung als „honestus iuvenis“ Johannes Georg Haug, Sohn des Hans Georg Haug und seiner Gemahlin Anna Staigerin, bezeichnet.
Seine Braut, die am Montag, den 2. November 1668 geborene „virgo“ Christina Greterin, heiratete er an einem Donnerstag: Die Trauung fand am 29. Oktober 1691 in St. Ägidius in Hirschau statt.
Nach der Eheschließung wurden acht Kinder geboren:
- Bereits kurz nach der Hochzeit kam Tochter Elisabeth Haug zur Welt und wurde am 4. November 1691 getauft. Paten waren Nikolaus Kaus und Maria Magdalena Maier („Domesticatrice mea“?). Elisabeth starb am Freitag, den 22. März 1743 „patientia in gravi morbo cum…“
- Sohn Petrus Haug kam im Mai 1695 zur Welt und wurde am Mittwoch, den 29. Mai getauft. Seine Paten waren Nicolaus Haug[ und Maria Magdalena Staigerin.
Nikolaus Haug war möglicherweise ein Onkel. - Am 27. Februar 1697 (Samstag) wurde Anna Maria Haug getauft (Paten: Nikolaus Kaus und Magdalena Staigerin). Anna Marias Firmung fand am 27. Januar 1697 statt und wurde von Pfarrer Johannes Chrysostomos Schweizer durchgeführt. Anna Maria starb am Samstag, den 27. November 1745.
- Im Jahr darauf fand am Sonntag, den 9. Oktober die Taufe der Tochter Catharina Haug statt (deren Paten waren Nikolaus Kaus und Magdalena Staigerin); Catherina verstarb am Samstag, den 8. August 1733.
- Lazarus Haug wurde im Oktober 1701 geboren. Nikolaus Knaus und Magdalena Staigerin waren am Mittwoch, den 12. Oktober die Paten. Lazarus Haug war mit Elisabetha Mayerin verheiratet. Im August 1733 wurde Sohn Laurentius Haug geboren und am 19. August (Mittwoch) getauft. Paten waren Mathäus Friedrich und Christina Binderin. Offenbar starb Lorenz am Montag, den 18. Februar 1805. Auch das zweite Kind war mit Gabriel Haug ein Sohn, der am Samstag, den 24. März 1736 getauft wurde. Matthes Friedrich und Christina Binderin waren die im Kirchenbuch verzeichneten Paten. Gabriel, „parvulus filius Lazari Haug“, starb im Alter von 15 Jahren und 3 Tagen offensichtlich krank („morbe repentina cum 1. anisius et obloe“) am Sonntag, den 20. Juni 1751 „hor 6 vesper…“ an „sponi Hydropisis parentam culpa sine lux eterna obiit“. Elisabetha Haug wurde am 21. Januar 1739 (Mittwoch) getauft. Mathäus Friedrich und Christina Binderin übernahmen erneut die Patenschaft. Am Samstag, den 31. Dezember 1740 wurde Christina Haug getauft, als Paten werden Matthäus Friedrich und Christina Binderin genannt. Als Paten von Bartholomäus Haug sind am Dienstag, den 22. August 1747 Matthäus Friedrich und Elisabetha Schneiderin verzeichnet. Johannes Georgius Haugs Taufe erfolgte am Donnerstag, den 9. April 1750. Auch seine Paten waren Matthäus Friedrich und Elisabetha Schneiderin. Johannes, „vixit, ut virum et christianus decet“, starb am Montag, den 9. Juni 1777 im Alter von 27 Jahren. Der „hon. viduus“ Lazarus Haug war seit dem 18. Januar 1751 (Montag) in zweiter Ehe mit Anna Maria Mayerin aus Hirschau verheiratet. Trauzeugen waren Petrus Hartmann und Johannes Hemmerle. Anna Maria wurde die Mutter von Joseph Haug („natus in Hungaria et baptizatus“) wurde. Als Paten sind am 8. Juli 1752 (Samstag) Joseph Schabat? und Maria p [sic!] genannt. Joseph Haug starb am Donnerstag, den 10. März 1803. Lazarus Haug („flilius Joan. Georgii Haug“) „obiit [in] Berwall [Perbál-Perwall] in Hungaria“. Er starb also im Alter von 53 Jahren [„aetas“] am 12. Januar 1754 (Samstag) in Ungarn und wurde dort am Dienstag, den 22. Januar beerdigt. Diese Nachricht erreichte Hirschau allerdings erst nach dem 22. Mai 1754, also knapp vier Monate nach Lazarus Haugs Tod: Lazarus Haug „obitus sanctus? id/it? libera? testimonia.“ Die Gemeinde Perbál-Perwall liegt ca. 20 km von der ungarischen Hauptstadt Budapest entfernt. 1686 wurde die Residenzstadt Ofen-Buda nach schweren und zähen Kämpfen von den verbündeten christlichen Heeren unter Kaiser Leopold I. (1657 – 1705) von der 150 Jahre währenden türkischen Herrschaft befreit und das ganze Gebiet südlich von Gran (Esztergom) und dem Donauknie, das Ofen-Pilischer Bergland sowie das Komitat Pilish befreit. Während der Türkenherrschaft wurden über 60% der mittelalterlichen Siedlungen vernichtet. Die Wiederbesiedlung des Pilischer Komitates wurde erst nach dem Kuruzenaufstand 1711 systematisch begonnen, wozu die Besitzerverhältnisse geklärt und die rechtmäßigen, ehemaligen Grundbesitzerfamilien und Erben urkundlich festgestellt sowie das Recht der Besiedlung in den befreiten Gebieten (lat.: „neoacquisita“; falls keine Erben vorhanden waren, sollten Güter neu vergeben werden) gesetzlich geregelt werden mussten. Die wiedereroberten und entvölkerten Dörfer und Marktflecken sollten neu besiedelt werden. Zur Durchführung dieser Aufgabe hatte Kaiser Leopold I. in Wien eine Kameralverwaltung eingesetzt. Einerseits sollten die Städte bevölkert, gleichzeitig aber auch das ländliche Gebiet besiedelt werden, um dem verarmten Ungarn zu Wohlstand zu verhelfen, weshalb die verödeten und verwilderten Landstriche durch Rodung und Trockenlegung kultiviert und Äcker und Wiesen bearbeitet werden sollten. Die Grundherren starteten Werbeaktionen und suchten für das verwüstete und verödete Land tüchtige Arbeitskräfte. Die Kameraladministration beschloss außerdem zur Beschleunigung der Neubesiedlung, dass siedlungswillige In- und Ausländer zuächst für drei bzw. fünf Jahre von Steuern und Leistungen befreit werden sollten (Impopulationspatent). Außerdem wurde ihnen Freizügigkeit gewährt. Die alte ungarische Adelsfamilie Zichy, die während der Türkenkriege treue Anhänger der ungarischen Könige aus dem Hause der Habsburger geblieben waren, besiedelte die entvölkerten Orte ihrer Grundherrschaft mit Deutschen: In drei großen Schwabenzügen, die bis zum Jahr 1787 andauerten, zogen diese in den Ddonauraum. Auf der Grundlage der Pfarrmatrikel, Komitatskonskriptionen, des Aktenmaterials des ungarischen Landesarchivs in Budapest und der kirchlichen Visitationsprotokolle erforschte der Pilisvörösvárer Abtpfarrer Stefan Marlok die Besiedlung Perbáls (vgl. Jubiläumsjahrbuch (Schematismus) des Bistums Stuhlweißenburg-Székesfehérvár, 1977) und belegt die Besiedlung Perbáls mit einzelnen Daten (S. 40ff.). Die planmäßige Besied-lung Perbáls begann etwa um 1743, als Perbál der Zichy’schen Domäne einverleibt war und nach der großen Pestseuche 1739. Infolgedessen muss auch Lazarus Haug nach Ungarn gegangen sein.
- Johann Haug wurde am Montag, den 3. Mai 1704 geboren.
- Maria Agathe Haug kam am 3. Oktober 1705 (Dienstag) zur Welt. Am 16. Juli 1736 heiratete „honoris viduus“ Jacob Zimmermann Maria Agatha Haugin in Hirschau. Sie starb am 3. / 30. November 1762 im Alter von 57 Jahren an „pleuriti de physica“.
- Für den Oktober des Jahres 1707 ist die Geburt von Regina Haug verbürgt, als deren Patin unter anderem Maria Agatha Staigerin im Kirchenbuch vermerkt ist (der Rest ist unleserlich).
Nach der Geburt des achten Kindes verstarb Christina Greterin am Montag, den 31. Oktober 1707 im Wochenbett: „Subsine anni … mulier et puerpera (Wöchnerin) Christina Greterin, cuius … dubie …“. Auch die kleine Regina starb bald.
Am 23. November 1705 (Montag) wird Hans Georg Haug im Hirschauer Taufbuch als Pate von Johannes Mayer genannt. Möglicherweise war der Säugling verwandt mit Hans Jergs zweiter Ehefrau Sabina Mayerin.
Im Jahr 1707 sind außerdem Johannes Georgius sowie Maria Haugin als Paten von Anna Maria Mayer (Sonntag, den 13. Januar) genannt. Am Sonntag, den 17. Januar 1707 fand die Taufe von Anna Maria Staiger statt, bei der ebenfalls ein Johannes Georgius Haug als Pate fungierte. Hans Jörg Haug und Maria Haugin werden am 19. Mai 1707 (Donnerstag) erneut als Paten genannt, Patensohn war Urbanus Mayer. Am 25. Januar 1711 (Sonntag) sind Hans Jörg Haug und Maria Haugin als Taufpaten von Carolus Mayer verzeichnet.
Johannes Georg Haug (1654 – 1713) und Sabina Mayerin (* 1686)
Nach dem Tod seiner zweiten Frau Christina Greter ging der bald 54jährige Witwer nämlich kein Halbes Jahr später erneut die Ehe mit der deutlich jüngeren Sabina Mayerin ein, die bei der Hochzeit 22 Jahre alt war. Die junge Frau und Hans Jerg Haug waren seit dem 22. April 1708 (Sonntag) verheiratet und bekamen drei Kinder:
- Als erstes gemeinsames Kind wurde am Montag, den 15. April 1709 die Tochter Regina Haug geboren. Nikolaus Kaus und Maria Agathe Staigerin waren am selben Tag ihre Paten.
- Nikolaus Haug kam im Dezember 1710 zur Welt und wurde am Nikolaustag (Samstag) getauft. Nikolaus Kaus und Maria Agathe Staigerin werden als seine Paten genannt. Nikolaus starb am 19. September 1778.
- Im August 1714 erblickte Theresia Haug das Licht der Welt in Hirschau. Der Tag der Taufe war Freitag, der der 14. September; als Paten sind Nikolaus Kaus und Maria Agatha Staigerin verzeichnet. Der Vater der kleinen Theresia war zu diesem Zeitpunkt bereits 60 Jahre alt.
„Jung Hans Jörg Haug“ wird am Freitag, den 25. Oktober 1709 als Pate von Christopherus Mayer genannt, außerdem am 2. März 1711 (Montag) als Pate von Anna Maria NN, ebenso am 30. Dezember 1712 (Mittwoch) als Pate von Agnesa Mayer. Auch bei Michael Mayer war Jung Hans Jörg Haug am 25. September 1713 (Montag) Taufpate.
Der Ehemann und elffache Vater Johannes Georgius Haug starb 1713, „omnibus rite provisus Sacramentis noctu circa horam primam piussime in Domino obier…vit, cui Deus est? Aeternam felicitatem?“[
Petrus Haug (1695 – 1764) und Martha Hemmerlin (1699 – 1753)
Der Ende Mai 1695 als Sohn von Hans Jerg Haug und Christina Greterin geborene Petrus Haug – älterer Bruder des nach Ungarn ausgewanderten Lazarus Haug – heiratete am Sonntag, den 26. November 1719 Martha Hemmerlin aus Hirschau, die am 1. März 1699 (Mittwoch) zur Welt gekommen war: „matrimonium contraxerunt honsestus Juvenis Petrus Haug et Martha Hemmerlin“. Der Pfarrer hatte die Braut zunächst Elisabetha genannt, den Namen aber durchgestrichen und Martha darüber geschrieben.
Der Hirschauer Bürger und Bäcker Petrus Haug und sein Eheweib hatten zehn Kinder:
- Marcus Haug (* 24. April 1721 (Donnerstag); ~ 25. April 1721 (Freitag); Paten: Sebastian Ehni, Anna Maria Haugin)
- Johannes Haug (* Mitte Juni 1723; ~ 17. Juni 1723 (Donnerstag); Paten: Sebastian Ehni, Anna Maria Haugin). Johannes Haug starb am 10. Januar 1783 mit 59 Jahren an „febri acuta“. Der Pfarrer notierte im Kirchenbuch: „uxoratus […,] vir probatima vita […,] speculum pathio in morbo lethifero, identidem imminabat fiatvoluntas Anna Haug [unleserlich]“. Der Pfarrer vermerkte beim Namen des Vaters Petrus außerdem einen Zusatz, der schwer zu lesen ist und noch entziffert werden muss.
- Juditha Haug (* Anfang Januar 1726; ~ 4. Januar 1726 (Freitag); Paten: Sebastian Ehni, Anna Maria Haugin; zu Sebastian Ehni ergänzte der Pfarrer im Taufbuch einen schwer zu entziffernden Zusatz); Judith starb mit 14 Jahren am Sonntag, den 26. Juni 1740.
- Nicolaus Haug (Paten waren am Montag, den 24. November 1727 Sebastian Ehni und Anna Maria Haugin); Nicolaus ist mein direkter Vorfahr; † 24. Januar 1781 (Mittwoch)
- Eutropia Haug wurde am Sonntag, den 29. Oktober 1730 getauft, Paten waren Sebastian Ehni und Anna Maria Haugin. Am Donnerstag, den 10. August 1747 wurde sie in Hirschau konfirmiert. Eutropia war Patin der am 24. Dezember 1754 (Samstag) in Hirschau getauften Christina Gemella Hemmerle (die eine Zwillingsschwester Catharina hatte). Eutropia Haugin war seit dem 11. Januar 1753 mit Aegidius Kittel verlobt. Trauzeugen waren bei der Eheschließung am 22. Februar Johannes Hemmerle und Johannes Martin Binder. Eutropia wurde Anfang Dezember 1755 Mutter. Ihr Sohn Nicolaus Kittel wurde am Mittwoch, den 3. Dezember getauft. Als Paten sind Godefriedus Schall und Elisabeth Binderin genannt. Eutropia, „uxor Aegidii Kittel […, suscepta solum ex poema unctioe [sic!] ex culpa suorum]“, starb am Freitag, den 14. März 1760, „aetatis sub 30“, an bösartigem bzw. hohem Fieber („febri maligna mortua est“).
- Agnes Haug kam 1733 zur Welt. Ihre Paten waren am 2. Januar (Freitag) Sebastian Ehny und Anna Maria Haugin. Agnes wurde am 10. August 1747 (Donnerstag) gefirmt. Sie starb am Mittwoch, den 20. Februar 1799.
- Achatius Haug wurde am Dienstag, den 11. Oktober 1735 getauft. Dieses Mal waren Sebastian Ehny und Anna Binderin die Paten. Achatius genannt Achaz wurde am Donnerstag, den 10. August des Jahres 1747 im Rottenburger Dom St. Martin gefirmt. Am 20. November 1759 (Donnerstag) war er Pate bei Catharina Hingher, am 31. Juli 1763 (Sonntag) bei Ignatius Hingher, am 20. Oktober 1765 (Sonntag) bei Catharina Hingher. „hon. iuvenis“ Achatius Haug war seit Montag, dem 7. Juni 1762 mit „pudica virgo“ Elisabetha Friedrichin verheiratet. Die Mitgift war bei der Verlobung am 29. Mai (Freitag) festgelegt worden, Trauzeugen waren Johannes Georg Staiger „cui fabriciio“ und Johannes Hemmerle „oditus“. Da das erste Kind bereits im November geboren und die Braut bei der Hochzeit schon schwanger gewesen war, strich der Pfarrer das Wort „honestus“ bei Achaz nachträglich durch. Insgesamt hatte die Familie 10 Kinder: Am 21. November 1762 wurde Sohn Clemens (?) Haug („6to post nuptias mense natus“) getauft. Paten waren Augustinus Schäffer und Caecilia Endreßin. Clemens starb am 3. Januar 1767 im Alter von viereinhalb Jahren. Friedericus Haug wurde am 19. Februar 1765 getauft. Paten waren wieder Augustinus Schäffer und Caecilia Endreßin. Friedrich wurde 1777 gefirmt. Er starb offenbar 1818. Am 9. Januar 1767 fand die Taufe von Genovefa Haug statt. Erneut waren August Schaeffer und Caecilia Aendres sind als seine Paten aufgeführt. Genovefa heiratete mit 21 Jahren am 21. August 1788 den gleichaltrigen Franz Joseph Hingher, mit dem sie in Haus Nr. 79 in Hirschau lebte. Philippus Haug kam im März 1769 zur Welt und wurde am 25. März getauft. Augustinus Schäfer und Caecilia Endreßin waren wieder die Paten. Philipp Haug starb am 11. März 1776 im Alter von sieben Jahren. Im Kirchenbuch finden sich dazu keinerlei weitere Angaben. Damasus Haug wurde am 11. Dezember 1771 in Hirschau getauft. Augustinus Schäfer und Caecilia Endreßin waren die Paten. Damasus wurde 1783 gefirmt. Am 21. Juli 1789 war er Trauzeuge bei Jakob Haug und Domitilla Zimmermann und am 30 April 1792 bei Johannes Friedrich und Ita Binderin. Damasus heiratete am 3. Oktober 1808. Der Name der Ehefrau ist im Familienregister nicht verzeichnet. Auch wann Damasus Haug starb ist offen. Petrus Haugs Taufe fand am Mittwoch, den 20. Februar 1774 in Hirschau statt. Als Paten sind Augustines Schäfer und Caecilia Endreßin genannt. Im Jahr 1786 wurde er gefirmt. Er starb am 21. September 1845. Caecilia Haug wurde am 10. April 1776 getauft. Augustin Schäfer und Caecilia Endresin waren zum wiederholten Mal die Taufpaten. 1788 wurde „Zäzilia“ gefirmt. Kaum 21 Jahre alt, heiratete am 13. Juni 1795 den 31jährigen Witwer Sebastian Binder, mit dem sie in Haus Nr. 26 lebte. Trauzeugen waren Franz Friedrich („beede“) und der verheiratete Anton Friedrich. Thomas Haug kam im Dezember 1778 zur Welt. Seine Taufe erfolgte am 14. Dezember, Paten waren Augustin Schäfer und Caecilia Endresin. Der kleine Thomas starb bereits acht Tage nach seiner Geburt am 22. Dezember 1778. Im Hirschauer Kirchenbuch finden sich dazu keine weiteren Bemerkungen. Anna Maria Haugs Taufe erfolgte am 27. September 1780 in Hirschau. Wieder waren die Paten Augustin Schäfer und Caecilia Endresin. Anna Maria wurde 1792 gefirmt. Am 27. Oktober heiratete die 20jährige den vier Jahre älteren Johannes Martinus Endreß. Trauzeugen waren der ledige Lorenz Latus und der verheiratete Matthias Schall Die Familie lebte in Hirschau in Hasu Nr. 39. Anna Maria Endreß (geb. Haug) „obiit 8. May 1819. Puerpera“ – sie starb also nach der Geburt eines Kindes im Wochenbett. Ignatius Haug, geboren im Juli 1783 („media ad 6ta vespertina“), wurde am 31. Juli getauft. Bartholomäus Hemmerle und Caecilia Endresin wurden als Taufpaten gewählt. Ignatz wurde 1795 gefirmt. Auch als Trauzeuge trat Achatius Haug (Bruder von Nicolaus Haug, Sohn von Petrus Haug und Martha Hemmerin) zunächst am 24. Februar 1783 bei der Hochzeit von Martinus Binder und Anna Maria Knoblin in Erscheinung, und auch am 16. Februar 1784 bei der Hochzeit von Philippus Keßler Anna Maria Wohlschießin. Achatius Haug war auch Pate bei Johannes Hingher, dessen Taufe am 31. Mai 1796 stattfand. „Wittiber Achaz Haug“ starb am 10. Mai 1792 in Haus Nr. 93 „im 56 Jahr“ in Hirschau an der Wassersucht, nachdem seine Ehefrau Elisabetha bereits am 20. Februar 1785 verstorben war. Der Pfarrer notierte: „caret“.
- Im März 1738 kam Anna Haug zur Welt und wurde am 21. März (Freitag) getauft. Erneut fungierten Sebastian Ehny und Anna Binderin als Paten. Das Taufbuch vermerkt außerdem: „obiit 31maMartis 1795“. Das war ein Dienstag. Anna wurde 61 Jahre alt.
- Elisabetha Haug, ein weiteres Mädchen, wurde am Samstag, den 15. Oktober 1740 getauft. Sebastian Ehni, schon geübt, und Anna Maria Hemmerlin übernahmen die Patenschaft.
- Mit Antonius Haug kam im Februar 1743 noch ein Junge zur Welt, dessen Taufpaten Sebastian Ehni und Anna Maria Hemmerlin waren. Antonius, „maritus Cath. Ehing. 25 an 4 mens 22 dies […,] sacrifici, devoti, grati “, verstarb mit 26 Jahren am Dienstag, den 30. Januar 1770. Im Kirchenbuch ist vermerkt: „Febris acuta, infam ex procedenti casu“.
Petrus Haug wird im Jahre 1735 – neben Nikolaus Friedrich, Johann Ladus dem Älteren, Egidi Binder und seiner Frau Anna Binderin, Martin Friedrich sowie den Geschwistern Meier (Jakob, Johann, Josef, Karl nebst Ehefrau Anna Maria, Regina und Theresia) als „Inhaber und Besitzer der lehnbaren Backküche und Brottaverne zu Hirschau“ in einer von Kaiser Karl VI. ausgestellten Urkunde erwähnt: Die o.g. Personen geruhten „allergnädigst […] die 2 halben Teil aus der Backküche und Brottaverne zu Hirschau in der Grafschaft Hohenlohe zum Leihen […] von uns [Karl VI.] zu empfangen […]. Und sie soll[t]en darum jährlich in unser Amt Rottenburg Zinsen“ bezahlen und „1 Frischling oder 6 Schilling dafür reichen“, außerdem „einen Weingarten auf ihre Kosten zu halben Teil bauen“ sowie „uns [Karl VI.] allzeit getreu gehorsamst dienstlich“ sein. Unterzeichnet von „Commisio s. Cas et Regia Cath. Mayenstatisin Consilio L.A. Lachmaier“.
Außerdem war Petrus Haug am 17. Juli 1720 (Mittwoch) Taufpate von Jacobus Raf, am 20. September 1722 (Montag) bei … Raf, am 2. August 1725 (Donnerstag) bei Aegidius Raf, am 7. April 1727 (Mittwoch) bei Johannes Georgius Raf, am 14. Oktober 1729 (Freitag) bei Gaudentius Raff, am 7. Juni 1732 (Samstag) bei Catharina Raf, am 19. November 1734 (Freitag) bei Andreas Raf, am 7. Dezember 1737 (Donnerstag) bei Niclaus Raf, am 15. April 1740 (Freitag) bei Marcus Raf, am 30. September 1741 bei (Freitag) Johannes Petrus Schr…, am 18. Februar 1744 (Dienstag) bei Francisca Raff, am 6. April 1743 (Samstag) bei Petrus Raff und am 26. März 1754 (Dienstag) bei Regina Binderin.
Martha Hemmerlin, „permat. pro … virg. et optima“ und Petrus Ehefrau, starb am Mittwoch, den 6. Juni 1753 im Alter von 54 Jahren: „resign. post diuturn. morb. eadem hectica“ – die Todesursache war also wohl Schwindsucht. Sie hatte in 23 Ehejahren 10 Kinder geboren. Bei ihrem Tod war ihr jüngster Sohn zehn Jahre alt.
Petrus Haug, „viduus & saper Autum & pod… Parens honestus et pius Indicus pagani membrus optimo … vir Sacrotamenvicatico non nisi post factum prius non consecato sumptione periculum, a quo intimito, et cochleari argenteo mediante perrecto […,] nat. 29. may 1645 Ipso, quo dec… die ss …, et plena in dulg. hora noctis 7da rite munitus”, starb im Alter von 69 Jahren und 3 Monaten in der Nacht vom 5. auf den 6. September 1764 in Hirschau. Er hatte seine Ehefrau Martha um etwas mehr als elf Jahre überlebt.
Petrus und Marthas im Herbst 1727 in Hirschau geborener Sohn Nicolaus Haug ist mein direkter Vorfahr.
Nicolaus Haug (1727 – 1781) und Anna Maria Hingherin[ (1712 – 1760)
Nicolaus Haug, Sohn von Petrus Haug und Martha Hemmerlin, wurde Ende November 1727 geboren und am Montag, den 24. November in Hirschau getauft. Seine Paten waren Sebastian Ehni und Anna Maria Haugin.
Gemeinsam mit Frantz Haug und Anton Haug (über deren Verwandtschaftsverhältnis noch nichts bekannt ist) sowie 93 anderen Jungen und Mädchen wurde Nicolaus Haug in Hirschau gefirmt. Leider kann man dem Kirchenbuch weder das Jahr noch das genau Datum entnehmen, anzunehmen ist das Jahr 1741.
„Niklaus Haug“ war Bürger und Weingärtner in Hirschau. Der „hon. iuvenis“ Nicolaus Haug und die im Juni 1712 geborene „hon. vidua“ Anna Maria Hingherin waren seit Samstag, dem 12. Januar 1754 verlobt und seit dem 28. Januar verheiratet. Die Trauzeugen des Paares waren Johannes G… und Remigius Pflum. Die Trauung hatte an einem Montag in der Kirche St. Ägidius stattgefunden.
Das junge Ehepaar bekam ein gutes Jahr später einen Sohn:
- Franciscus Haug wurde am Sonntag, den 9. Februar 1755 in Hirschau getauft. Johannes Martinus Endreß und Agnes Hemmerlin waren seine Paten. Im Familienregister Hirschaus wird Franciscus als „Reebmann“ bezeichnet.
Nicolaus Haug war, wie sein Vater und Großvater, auch selbst Taufzeuge: Am Sonntag, den 4. Januar 1756 ist er als Pate bei Juliana Ruepp genannt, am 13. Januar (Dienstag) war „Nicolaus Haug Jung“ Pate bei Melchior Friedrich und am 1. Dezember 1759 (Samstag) bei Johannes Evangelistus Ruepp.
Er fungierte außerdem am Montag, den 23. Juli 1770 als Trauzeuge für Johannes Knobel und Anna Maria Schnizler und wohl am 10. oder 11. August des Jahres 1772 als Firmpate bei Casimirus und Josephus Kaltenmarck.
Nicolaus‘ Weib Anna Maria Hingherin starb am Dienstag, den 25. November 1760 als „uxor … viri nicolai haug“, „mulier pia et Deo devota munita omnibus ss sacramentis“. Als Todesursache ist Wassersucht angegeben, „Hydropisi mortua est“. Die Wassersucht (Hydrops) ist eine Krankheit des lymphatischen Systems, wobei sich im Zellgewebe Wasser einlagert.
Der kleine Sohn Franciscus war zu diesem Zeitpunkt fünfeinhalb Jahre alt. Über weitere Kinder des Paares ist mir nichts bekannt. Der 33jährige Witwer heiratete gerade einmal vier Monate nach dem Tod seiner ersten Frau ein erneut.
Nicolaus Haug (1727 – 1781) und Anna Zimmermännin (1735 – 1763)
Nicolaus Haug junior, gelegentlich auch Niclaus genannt, Bürger und Weingärtner, und seine zweite Ehefrau Anna Zimmermännin lebten um die Mitte des 18. Jahrhunderts in Hirschau und waren die Eltern des ersten im Familienstammbaum dokumentierten Vorfahren Petrus Haug, der gleich zu Beginn des Jahres 1762 geboren wurde.
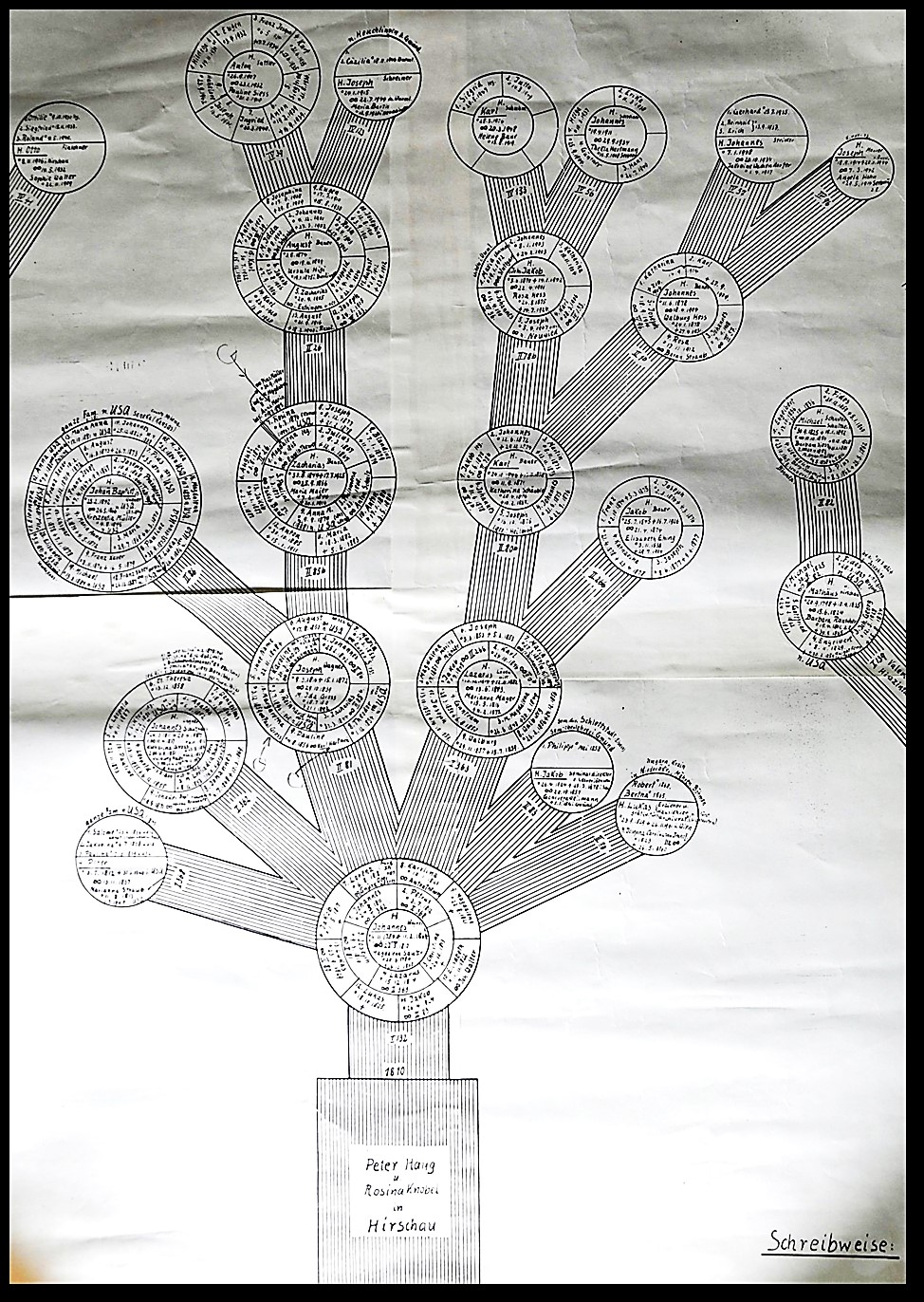
Den Stammbaum erstellte der ehemalige Wurmlinger Pfarrer Gustav Bolsinger in den 1950er Jahren – für 5 DM.
Bis zu Petrus Haugs Ururgroßeltern Hans Georg Haug und Anna Staigerin kann ich meine Abstammung wie beschrieben bisher lückenlos zurückverfolgen, allerdings ist Näheres – zum Beispiel in Bezug auf die Berufe dieser Vorfahren oder wo ihre Häuser standen etc. – bisher nicht oder nur lückenhaft bekannt.
Nicolaus Haugs zweite Ehefrau Anna Zimmermann kam wohl am Mittwoch, den 30. März 1735 in Hirschau zur Welt. Gesichert ist, dass „honestus viduus Jung“ Nicolaus Haug und „honesta ac purica virgo“ Anna Zimmermännin sich am Samstag, den 24. Januar 1761 die Ehe versprachen und die Mitgift vereinbarten. Die Hochzeit fand eine Woche später am Sonntag, den 1. Februar in Hirschau statt. Trauzeugen des Brautpaares waren Hans Martin Latus und Johannes Hemmerle.
Nicolaus Haug und Anna Zimmermännin hatten zwei gemeinsame zwei Kinder:
- Petrus Haug (~ 12. Januar 1762 (Dienstag); Paten: Johannes Martin Endriß und Agnes Hemmerlin)
- Caecilia Haug (~ 9. November 1763 (Mittwoch); Paten waren Hans Martin Endriß und Agnes Hemmerlin)
Anna Zimmermännin, „uxor Nicolai Haug Hirschauii, nata 30mo mart. 1735“, starb bald nach der Geburt der Tochter im Alter von wohl 28 Jahren am Mittwoch, den 30. November 1763: „aet. 28 … pridie, ac indul. plen. munita et optime deposita“; als Todesursache wird im Kirchenbuch eine Frühgeburt angegeben: „In abortu prolis solemniter spoleto et consepulte“ angegeben.
Im Todesjahr der Anna Zimmermännin (1763) wurde im Rahmen der Josephinischen Reformen des spätabsolutistisch-aufgeklärten österreichischen Kaisers Joseph II. auch in den vorderösterreichischen Territorien die Personalleibeigenschaft aufgehoben. Nicolaus Haugs Sohn Petrus mag die nun größere soziale Bewegungsfreiheit im Laufe seines Lebens bereits von Nutzen gewesen sein, denn die Mobilitäts- und auch die Verehelichungsvorschriften wurden im Rahmen dieser Reformen gelockert.
Nicolaus Haug (1727 – 1781) und Anna Maria Knobel (1739 – 1793)
Als am Sonntag, den 15. Januar 1764 das Verlöbnis mit der am 7. September 1739 (Montag) geborenen Anna Maria besiegelt wurde, wurde auch die Mitgift festgelegt, und so heiratete der bereits zweimal verwitwete Bürger und Weingärtner Nicolaus Haug („honestus viduus“) acht Wochen nach dem Tod seiner zweiten Ehefrau Anna Zimmermännin 1764 erneut. Die Trauzeugen waren sein sieben Jahre jüngerer Bruder Achatius Haug, Elisabetha Friedrichin und Johannes Hemmerle.
Allerdings hatte es im Vorfeld dieser Eheschließung Schwierigkeiten gegeben, da die Verlobten zu nah miteinander verwandt waren. Hierzu muss noch genauer geforscht werden. Möglicherweise waren der Bräutigam und die Braut Cousin und Cousine.
Doch nachdem die Verbindung durch einen Dispens des Rottenburger Bischofs genehmigt worden war („In IV affinitatis a quat[ru]s gradu dispensati consta … viduus ecclesia? Exam. iur. in siano ad 18. Jan. 1764“), konnte die Trauung am Dienstag, den 31. Januar 1764 vollzogen werden.
Nicolaus‘ Söhne Franciscus und Petrus waren nun acht bzw. gerade zwei Jahre alt. Ob die kleine Caecilia noch lebte ist mir nicht bekannt.
Niclaus Haug bekam mit seiner dritten, zwölf Jahre jüngeren Ehefrau, der „pudica virgo“ Anna Maria Knoblin (* 7. September 1739), noch sechs weitere Kinder:
- Valentin Haug (1765 – 1825) wurde etwa ein Jahr nach der Hochzeit der Eltern geboren und am 30. Januar 1765 (Mittwoch) getauft. Seine Paten waren Hans Martin Endreß und Agnes Hemmerlin. Der Halbbruder von Petrus und Bruder von Eugenius (Eugen) sowie Antonius (Anton) Haug war 1785 noch ledig, als er am 19. Juli (Dienstag) beim 23jährigen Anton Schneider und seiner 27jährigen Braut Anges Staigerin als Trauzeuge fungierte. Bereits „verhelicht“ wird er als Trauzeuge von Petrus Haug, 34 Jahre alt, und Margaretha Fuhrerin, 29, genannt, die am Montag, den 9. November 1795 in Hirschau geheiratet hatten. Valentin Haug war später Bürgermeister in Hirschau. Zunächst heiratete er mit 23 Jahren seine gleichaltrige Braut Maria Hyazintha Sailer (1764 – 1824) aus Birlingen. Die Trauung fand am Samstag, den 2. Februar 1788 in Hirschau statt. Trauzeugen waren der ledige Joseph Haug und der Meßmer Eberhard Hämmerle. Als Wohnort ist Haus Nr. 4 in Hirschau vermerkt. Der gemeinsame Sohn Jakob Haug wurde am Samstag, den 27. Juni 1789 getauft. Friedrich Haug und Franzisca Haug waren die Taufpaten. Im Januar 1791 wurde Anton Haug in Haus Nr. 87 geboren. Antons Paten waren Friedrich Haug und die verheiratete Franzisca Haug. Im Alter von „14 Jhren und 12 Tagen“ Jahren starb Anton Haug an einem Samstag. Der Pfarrer vermerkte im Taufbuch: „obiit 1da Martii 1806“. Im Sterbbuch ist die Todesursache notiert: „starb an zurückgekehrter rother Seuche“. Philipp Haug, geboren in Haus Nr. 87, wurde am 27. August 1793 (Dienstag) in Hirschau getauft. Erneut sind Friedrich Haug und die verheiratete Franzisca Haug als Paten genannt. Philipp starb im Alter von zweieinhalb Jahren am Freitag, den 18. März 1796 in Haus Nr. 87 an den Blattern. Vier Tage zuvor war sein jüngerer Bruder Franz verstorben. Allein zwischen Januar und März diesen Jahres starben in Hirschau mindestens zwei Dutzend Menschen vom Säugling bis zum Greis an dieser Krankheit Menschen. 1795 im März kam Franz Haug in Haus Nr. 87 in Hirschau als viertes Kind von Valentin und Hyazinta zur Welt. Die Taufe erfolgte am Samstag, den 28. März, Taufzeugen waren wiederum der verheiratetet Friedrich Haug und die ebenfalls verheiratete Franzisca Haug. Franz starb im Alter von 11 Monaten am Montag, den 14. März 1796 in Haus Nr. 87 an den Blattern – vier Tage vor seinem älteren Bruder Philipp. Anderthalb Jahre später wurde in Haus Nr. 87 Tochter Anna Haugin geboren und am Dienstag, den 2. November 1796 getauft. Noch einmal waren Friedrich Haug und Franzisca Haug als Paten ausgewählt worden. Anna starb am Samstag, den 14. April 1804 in Haus Nr. 5 an „einem Steckfluss“. Sie wurde sechs Jahre alt. Mit Matthäus Haug („baptisatus in Wurmlingen?“) wurde am Donnerstag, den 20. September 1798 ein weiteres Kind geboren. Friedrich Haug und Franzisca Haug, beide verheiratet, waren erneut die Taufzeugen. Matthäus Haug wanderte nach Wurmlingen ab, wo er am Dienstag, den 15. Juni 1824 Barbara Rauscher (* Montag, den 19. April 1802) heiratete. In der Beibringensinventur wurde das von den beiden Brautleuten in die Ehe eingebrachte Vermögen festgehalten. Sie beginnt mit Ort und Datum, dem Namen der Eheleute und dem Zeitpunkt der Verheiratung, dann folgt eine Beschreibung zunächst des Vermögens des Mannes und anschließend jenes der Frau, die beide das Inventar am Schluss unterzeichnen. Mit Barbara Rauscher bekam Matthäus Haug vier Söhne und eine Tochter: Michael Haug (* Freitag, 30. September 1825) war Schuster in Wurmlingen und heiratete dort am 10. Oktober 1854 Barbara Sieß (* Freitag, den 4. Dezember 1829; † Freittag, den 21. Januar 1881). Drei Eltern der Brautleute, Matthäus Haug sowie Georg Sieß und Maria Friedrich, waren (mit Ausnahme von Barbara Haug) zum Zeitpunkt dieser Eheschließung bereits verstorben, die der Wurmlinger Gemeinderat am Sonntag, den 10. September 1854 genehmigt hatte. Die Hochzeit wurde in Wurmlingen am 16., 17. und 18. Oktober proclamiert und von Pfarrer Bauer vollzogen. Gottfried Ehing und Georgia (?) Sieß waren die Trauzeugen. Der Schultheiß (1872 – 1892), Gemeinderat und Gemeindepfleger Michael Haug hatte drei Söhne und eine Tochter: Engelbert Haug kam am Freitag, den 17. Oktober „morgens 5 Uhr“ 1856 in Wurmlingen zur Welt – im Sterberegister notierte der Pfarrer „nachts“. Der Säugling wurde am Sonntag, den 19. „mittags ½ 11 Uhr“ von Pfarrer Bauer getauft. Seine Paten waren der Onkel und Schneider Conrad Ehing und Theresia Sieß. Engelbert lebte nur acht Tage und starb am Samstag, den 1. November an „Gicht“. Einen Tag später wurde er „morgens ½ 8 Uhr“ bestattet. Fides Haug wurde am Dienstag, den 20. Dezember 1859 „abends 5 Uhr“ geboren und am 22. Dezember von Pfarrer Schreiber getauft. Conrad Ehing und Margaretha Sieß sind als Paten verzeichnet. Fides starb am Donnerstag, den „5. Jan. Abds 9 Uhr“ mit 16 Tagen an „Gicht“. Am darauffolgenden Sonntagnachmittag (8. Januar 1860) wurde sie um 3 Uhr begraben. Pius Haug, geboren am Mittwoch, den 8. Mai 1862 „früh 6 Uhr“, wurde am selben Tag von Pfarrer Mayer getauft. Conrad Ehing und Margareth Sieß waren die Taufzeugen. Pius wurde nur 17 Tage alt und starb bereits um 5 Uhr morgens am 25. Mai 1862 (Samstag). Als Todesursache vermerkte der Pfarrer „Gichter und Unterleibentzündung“. Die Beerdigung erfolgte am Morgen des 27. Mai (Montag) um 8 Uhr. Wendelin Haug wurde am Montag, den 23. Oktober 1865 geboren und einen Tag später von Pfarrer Blank getauft. Seine Taufzeugen waren der Schneider Konrad Ehing und Margaretha Sieß. Wendelin besuchte die Oberrealschule in Reutlingen, wurde Ingeniuer in Böhmen und wanderte nach Staufenberg ab. Der Pfarrer notierte „Aus der Kirche ausgetreten am 11.11.1938“ und strich den ganzen Taufeintrag durch. Am Sonntag, den 23. Januar 1859 ist Michael Haug als Taufzeuge der Maria Paulina Beck genannt, der Tochter des Zacharias Beck und seiner Ehefrau Maria Anna Ehing. Barbara Sieß verstarb am 21. Januar 1881 „nachmittags 2 Uhr“ an „Brust-/Breist-/Brechfall? und Lungenentzündung“. Sie wurde am 23. Januar „vormittags 10 ½ h“ beigesetzt. Als Erben sind der Witwer Michael Haug, Schultheiß, und das einzige Kind Wendelin Haug genannt, der zu diesem Zeitpunkt die Oberrealschule in Reutlingen besuchte. In zweiter Ehe war Michael Haug mit Maria Anna Müller verheiratet, einer Tochter des bereits verstorbenen Wurmlinger Steinhauers Franz Sales Müller. Drei Brüder Maria Annas, Gabriel, Eduard und Michael Miller, waren in die USA emigriert. Ein Auswandererbrief vom 29. März 1896 und Formulare aus New York sind noch erhalten. Der Witwer Michael Haug starb am 18. Januar 1892 „nachmittags 11 h“ an „Lungentuberkulose“. Er wurde am 21. Januar „vormittags 9 h“ begraben. Seine Erben waren seine Witwe Marianne Miller und „sein Kind aus der ersten Ehe mit der ges[torbenen] Barbara Sieß: Wendelin Haug“. Seine Schwester Fides Haug (* Mittwoch, den 28. März 1827), „Bürgerstochter“, bekam 1852 ein uneheliches Kind, Theresa. Der Säugling starb mit „3 Monat 17 Tag“ am Samstag, den 5. Juni 1852 „morgens 3 Uhr“. Fides wanderte in die USA aus, wo sie in „Neuyork“ wohl den Möbelmacher Anton Gauß heiratete. Fides starb im Alter von „28 Jahr 4 Monat“ am 17/18. Juli 1854 in New York an „Gichter“ – der Pfarrer notierte als Todesort wiederum „Neuyork“. Erbe war ihr Bruder, der Gemeindepfleger Michael Haug. Ein Schreiben des Kaiserlichen Generalkonsulats in New York (1872) und eine Mitteilung des Staates Mississippi (1872) sind noch erhalten. Joh. Georg Haug wurde am Montag, den 12. Mai 1828 geboren; († Montag, den 25. August 1834). Engelbert Haug war ein Sonntagskind: geboren am 8. November 1829, hatte er die Firmung 1843 erhalten. Er wanderte ebenfalls in die USA aus und ging nach Knight Ferry, Kalifornien († Freitag, den 20. Februar 1859 in Kalifornien). Im Rottenburger Stadtarchiv finden sich ein Schreiben des Kaiserlichen Generalkonsuls in New York (1872) und eine Mitteilung des Staates Mississippi (1872). Der jüngste Sohn Gottfried Haug (* Donnerstag, den 23. Februar 1832; † Sonntag, den 24. März 1833) wurde nur ein gutes Jahr alt. Mätthaus Haug starb am Freitag, den 10. April 1835 im Alter von 34 Jahren (der Pfarrer notierte „37“) an Lungenentzündung und wurde am 12. April (Freitag) nachmittags um 2 Uhr beigesetzt. Seine Witwe Barbara Rauscher überlebte ihn um 30 Jahre. Sie heiratete in zweiter Ehe den Wurmlinger Bauern Vinzenz Ehing, Sohn des Webers Martin Ehing, mit dem sie weitere sechs Kinder bekam. Ausdrücklich notierte der Pfarrer, dass Anna Haugin als Tochter des Matthäus Haug am Mittwoch, den „5ten März [1800] geboren, und am 6ten M getauft“ wurde. Ihr Geburtshaus trug die Nummer 87, ihre Paten waren der verheiratete Ambros Haug sowie die ebenfalls verheiratete Franziska Haug. Kind Nummer acht war Michael Haug, im September 1801 in Haus Nr. 87 geboren und am Freitag, den 18. September getauft. Nun waren wieder Friedrich Haug und Franzisca Haug die Taufpaten. Rosina Haug, Anfang des Jahres 1803 in Haus Nr. 87 geboren und am Freitag, den 4. März getauft, war das neunte Kind der großen Familie. Friedrich Haug und Franzisca Haug waren schon geübt als Taufpaten.
- Theresia Haug (~ Mittwoch, den 15. Oktober 1766); Hans Martin Endreß und Agnes Hemmerlin waren auch ihre Paten.
- Gertrud Haug (~ Samstag, den 2. April 1768)
- Jacob Haug (~ Samstag, den 15. Juli 1769; Johannes Mayer und Agnes Hemmerlin waren die Paten des kleinen Jacob, der bereits am Dienstag, den 3. Oktober verstarb.)
- Eugenius Haug (~ 17. November 1771 (Sonntag); † 23. Februar 1848. Eugen, der wohl in Haus Nr. 4 in Hirschau geboren wurde, war Bürger und Weingärtner. Der Sohn des Bürgers und Weingärtners Nikolaus Haug und der Anna Maria Knobel war der Halbbruder von Petrus und der Bruder von Valentin sowie Antonius (Anton) Haug. Er war seit dem 14. Oktober 1799 (Montag) verheiratet mit der Tochter von Jacob Haug und Barbara Binderin, Ursula Haugin, mit der er später in Haus Nr. 98 in Hirschau lebte und 12 Kinder hatte. Ursula war die Tochter des Bürgers und Weingärtners Jakob Haug und der Barbara Binderin. Bei der Eheschließung war der Bräutigam 28 Jahre alt, die Braut 20. Der ledige Peter Haug und der verheiratete Jakob Haug waren die Trauzeugen. Dieser ledige Peter Haug war auch am 19. Juni Trauzeuge bei der Hochzeit des Lorenz Latus, 19, und der Anna Maria … Werzin, 20, die nach der Hochzeit in Haus Nr. 1 in Hirschau lebten. Eugen Haug und sein Weib Ursula Haug bekamen 12 Kinder: Clemens Haug wurde am Mittwoch, den 22. September 1802 geboren und starb am Sonntag, den 21. Agugust 1803 im Alter von 1 ½ Jahren in Haus Nr. 26 in Hirschau „an den Kindergichtern“. Clemens Haug kam am Dienstag, den 20. März 1804 zur Welt. Mit neun Monaten verstarb er am Samstag, den 27. Oktober 1804 in Haus Nr. 26 in Hirschau. Als Todesursache werden „Kindergichtern“ genannt. Maria Haug, geboren am 14. April 1805, war ein Sonntagskind. Sie wurde 1819 konfirmiert. Lorenz Haug wurde am Donnerstag, den 7. August 1806 geboren und im Jahre 1820 konfirmiert. Am 1. März 1807 wurde Barbara Haug geboren und 1821 konfirmiert. Auch C… Haug war ein Sonntagskind, das am 2. April 1809 geboren und 1823 konfirmiert wurde. Clemens Haug kam am Montag, den 10. Juni 1811 zur Welt, verstarb aber bereits am 21. Oktober (Montag). Magdalena Haug, geboren am Montag, den 20. April 1812, feierte 1826 Konfirmation. Johannes Haug wurde am Freitag, den 5. Februar 1813 geboren. Er starb noch im selben Jahr. Johann Georg Haug erblickte das Licht der Welt am Freitag, den 21. April 1815. … Georg Haug wurde am Freitag, den 15. März 1816 geboren. Das letzte Kind verstarb offenbar bei der Geburt bzw. wurde tot geboren. Ursula Haug starb am 26. Mai 1818. Der Witwer Eugen Haug verstarb am Montag, den 23. Februar 1848.
- Antonius Haug (~ Samstag, den 15. April 1775); Johannes Mayer und Anna Latusin waren die Paten. Der Bürger und Schmied Anton, Sohn des Bürgers und Weingärtners Nikolaus Haug und der Anna Maria Knobel und Bruder von Valentin und Eugen Haug sowie Halbbruder von Petrus, heiratete am Montag, den 9. Februar 1801 die Tochter des Bürgers und Schultheißen Fidel Werz und seiner Frau Regina Friedrichin, Anna Maria Werzin (* Donnerstag, den 15. August 1782), die ihm 12 Kinder schenkte: Fidel Haug, benannt nach dem Großvater mütterlicherseits, wurde am Dienstag, den 20. April 1802 geboren und starb am 6. März desselben Jahres. Johannes Baptist Haug kam am Donnerstag, den 18. August 1803 zur Welt und wurde 1816 gefirmt. Er starb am Montag, den 18. November 1861. Am Mittwoch, den 15. Januar 1806 wurde Felix Haug geboren. Er wurde 1819 gefirmt. Fidelis Haug erblickte das Licht der Welt am Mittwoch, den 17. Mai 1809, doch der Kleine starb schon am Mittwoch, den 9. August 1809. Die Zwillingschwester Margarita Haug wurde ebenfalls am 17. Mai 1809 geboren und 1823 gefirmt. Sie starb am Mittwoch, den 12. September 1877.Bartholomäus Haug kam am Freitag, den 23. August 1811 zur Welt, wurde 1826 gefirmt und starb am Samstag, den 7. Februar 1852. Möglicherweise war er mit verheiratet mit Theres Binder und hatte einen Sohn Engelbert (* 9. November 1848). Am Montag, den 23. Mai 1814 kam Maximilian Haug zur Welt, der 1828 gefirmt wurde und am Dienstag, den 6. April 1886 starb. Matthäus Haug wurde am Samstag, den 1. November 1817 geboren. Er starb am Sonntag, den 25. April 1886, keine drei Wochen nach seinem dreieinhalb Jahre älteren Bruder Maximilian. Genovefa Haug („…tente baptizata“), am Donnerstag, den 23. Dezember 1819 geboren, verstarb schon am selben Tag. Petrus Haug erblickte das Licht der Welt am Freitag, den 29. Juni 1821 und wurde 1836 gefirmt. Er starb mit 20 Jahren am Mittwoch, den 6. April 1842. Regina Haug wurde am Donnerstag, den 2. September 1824 geboren, 1838 gefirmt und starb (unleserlich). Das letzte Kind, Romanus Haug, wurde im August 1827 geboren und am Montag, den 27. August getauft. Die Firmung erfolgte im Jahr 1841. Offenbar lebte die Familie Haug in Haus Nr. 105 in Hirschau. Antonius Haug starb am Samstag, den 29. November 1862, nur zwei Wochen nach seiner Frau Anna Maria Haug Werz, die am Mittwoch, den 12. November 1862 verstorben war.
- Anna Haug (~ Donnerstag, den 4. November 1779; Paten waren „Johannes Mayer Junior“ und Anna Maria Latus. Im Alter von zwei Jahren und 5 Monaten starb „Anna Maria filia Nicolai Haug jun. defuncti et Anna Maria Knoblin“ am Samstag, den 6. April 1782. Der Pfarrer notierte dazu nichts weiter.
Der „honestus vir“ Nicolaus Haug, Vater von insgesamt zehn Kindern, starb im Alter von 53 Jahren am Mittwoch, den 24. Januar 1781 in Hirschau an hohem Fieber („actu febris consummatus“).
Er wird im Kirchenbuch als „vir iustus, pacificus et rectus“ bezeichnet, außerdem notierte der Pfarrer: „Matare orbus? LL./SS. Monitarienfindus Sacramentis roboratus pie obiit, reliquuerat 6 proles“.
Nicolaus dritte Ehefrau, Anna Maria Knobelin, starb 1793 als Witwe im Alter von 54 Jahren in Haus Nr. 55 „an der Auszehrung“.
Die Angabe der Hausnummer im Kirchenbuch ist interessant und wichtig, um beim Katasteramt eventuell Auskunft zu erhalten, wo genau dieses Haus in Hirschau stand.
Nicolaus und Anna Maria sind die Eltern meines Anfang des Jahres 1762 in Hirschau geborenen direkten Vorfahren Petrus Haug.
Petrus Haug (1762 – 1807) und Rosina Knobel (1765 – 1794)
Peter Haug, Sohn von Nicolaus Haug und Anna Zimmermännin, wurde zu Beginn des Jahres 1762 geboren und am Mittwoch, den 12. Januar getauft. 1772 nahm der zehnjährige Peter am Dienstag, den 11. August in Hirschau zum ersten Mal an der heiligen Kommunion teil.
Im Hirschauer Firmverzeichnis des Jahres 1772 werden außerdem als Firmlinge (mit den jeweligen „patrini“) Friedericus Haug (Carolus Kutterer), Valentinus Haug (?), Petrus Haug (Achatius Haug), Matthäus Haug (Ignatius Staiger), Genoveva Haug (Juliana Kameiser) und Victoria Haug (Anna Staiger) genannt, die wohl ebenfalls zum großen Kreis der weitläufigen Verwandtschaft zählen.
Im Firmverzeichnis des Jahres 1781 taucht der Name Haug (mit den jeweligen „patrini“) ebenfalls auf: „masculis confirmati“ waren Ignatius Haug (Ignatius Friedrich), Sigismundus Haug (Norbertus Hemmerlin), Casimirus Haug (Thomas Haug), Damasus Haug (Ignatius Stromayer), Fidelis Haug (Ignatius Stromayer), Petrus Haug (Ignatius Sromayer), Carolus Haug (Gerhard Hemmerle), Antonius Haug (Friederich Haug), Eugenius Haug (Norbertus Hemmerle), Martin Haug (Jacobus Latus) und Jacobus Haug (Johannes Martin Fridrich). „femella confirmata“ waren im selben Jahr Caecilia Haugin (Theresia Raafin), Ursula Haugin (Agatha Hartmännin), Anna Maria Haugin (Anna Rosina ?), Brigida Haugin (Agnes Schnitzerin), Mechtildis Haugin (Elisabetha Knoblin), Regina Haugin (Ursula Hemmerlin), Ursula Haugin (Rosina Knoblin), Walburg Haugin (Caecilia Hemmerlin), Ursula Haugin (Anna Maria Haugin), Caecilia Haugin (Elisabetha Hemmerlin) und Eleonora Haugin (Eleonora Geigerin). Genaueres ist noch nicht erforscht.
Mitte der 1760er Jahre gab es in Hirschau etwa 85 Haushalte, was einer Bevölkerung von etwas über 400 Einwohnern entsprach. Zahlenangaben für Herdstätten oder Bürger werden mit 5 multipliziert, um auf eine ungefähre Einwohnerzahl zu kommen. 92 der Hirschauer Einwohner besaßen das Bürgerrecht.
Auch der Weingärtner „alt Peter Haug“ war Bürger in Hirschau. Mit 21 Jahren heiratete der junge Mann („honestus iuvenis Petrus Haug“) am Montag, den 3. November 1783 die drei Jahre jüngere „purica virgo“ Rosina Knoblin (* Dienstag, den 19. Februar 1765) aus Hirschau.
Eine (lange) Verlobung war allgemein nicht üblich, und auch die Brautschaft von Peter Haug und Rosina Knoblin begann wohl mit der offiziellen „Bekanntschaft“: Braut, Bräutigam und der „GseII“ (Hochzeitslader) gingen gemeinsam in die Häuser von Bekannten und übermittelten die Einladung zur Teilnahme an der bevorstehenden Hochzeit.
Am Samstag, den 18. Oktober war zwischen Peter und der 18jährigen Rosina eine Mitgift vereinbart worden. Peters Onkel Achatius Haug (der jüngere Bruder seines Vaters Nicolaus) und Eberhard Hemmerle bezeugten die Eheschließung.
Sechs Jahre vor dem Ausbruch der Französischen Revolution lebte die Familie von Petrus und Rosina in einem Dorf, das zur Grafschaft Hohenberg und politisch damit zu Vorderösterreich gehörte. Das Ende des 18. Jahrhunderts war eine Phase des politischen Umbruchs, in der die Menschen gravierenden Veränderungen ausgesetzt waren. Am Vorabend der Französischen Revolution bot der deutsche Südwesten mit seinem kleinkammrigen Bauplan von mehr als 250 selbstständigen Territorien das klassische Bild der Kleinstaaterei im hochgradig zersplitterten Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Vier große Staaten im Südwesten (die Kurpfalz, die Markgrafschaft Baden, das Herzogtum Württemberg und die habsburgischen Erblande Vorderösterreichs) formten dabei das Territorium des heutigen Baden-Württembergs.
Viele der gesellschaftlichen und politischen Veränderungen des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts erlebten Peter Haug und seine Familie mit, unter anderem den strengen Winter 1788/89, den oben erwähnten schlechten Weinherbst 1789 sowie die folgenden mageren Ernten und Weinjahre bis 1793, durch die sich die Situation der Bauern in Bezug auf Ertrag und Versorgung deutlich verschlechterte.
Über den Beruf von Petrus Haug ist bekannt, dass er Landwirt und Weingärtner, vielleicht auch – wie später seine Söhne Johannes Evangelist und Franz Saless – Wagner war.
Peter und Rosina Haug bekamen sechs Kinder. Bei der Geburt des ersten Kindes war Rosina erst 19 Jahre alt, Petrus noch 21. Das erste Kind, Sohn Johannes, wurde ein Jahr nach der Hochzeit in Haus Nr. 33 geboren, weitere Kinder in Haus Nr. 71, so dass davon auszugehen ist, dass die Familie vor der Geburt des zweiten Kindes umgezogen ist.
In der Wurmlinger Kapelle befindet sich übrigens eine kleine Gedenktafel, die darauf verweist, dass 1812 fast die gesamte männliche Dorfjugend aus Hirschau und Wurmlingen der Expansionspolitik des französischen Kaisers geopfert wurde.
Im Jahr der Geburt des ältesten Sohnes Johannes Evangelist Haug (1784) dokumentiert das Kirchenbuch Hirschau eine Reihe von Berufen, beispielsweise Rebmänner, Weingärtner, Wassermacher, Bäckermeister, Weber, Zimmermeister, Schmiedmeister, Schneider, Schreiner, Maurer, Wannenmacher, Schäfer, Waldschütz, Wirt und den Zehnt-Inspektor, 1802 wird in den Akten 1 Barbier (Hemmerle) genannt und um 1828 waren 3 Bäcker, 2 Hufschmiede, 2 Küfer, 1 Kundenweber, 1 Lohnweber, 1 Webergehilfe, 3 Schneider und 1 Gehilfe, 1 Schreiner, 2 Schuhmacher und 2 Gehilfen, 2 Zimmerleute und 1 Gehilfe. Zwei Schildwirtschaften, eine unbeständige Wirtschaft und eine Bierbrauerei werden ebenfalls erwähnt. Außerdem waren 1 Schäfer, 3 Branntweinbrenner und 1 Korbmacher in Hirschau tätig.
Ein Jahr nach der Hochzeit wurde Peter und Rosinas erstes Kind geboren:
- Johannes Evangelist Haug kam Anfang November 1784 in Haus Nr. 33 in Hirschau zur Welt und wurde am Samstag, den 6. November in der Kirche St. Aegidius getauft. Seine Paten waren der ledige Johannes Latus („beede“) und die ledige Elisabeth Knobel. Johannes wurde 1796 gefirmt. Im Familienregister notierte der Pfarrer: „vereheligt den 22. May mit Magdalena Sauter“. Die Braut stammte aus Wurmlingen, wohin Johannes Evangelist nach der Hochzeit abwanderte. Er war von Beruf Wagner und ich vermute, dass auch sein Schwiegervater diesen Beruf ausübte. Jedenfalls gab es noch zu Beginn des 20. Jarhunderts in Wurmlingen einen Wagner Sautter. Auf meinen direkten Vorfahren Johannes Evangelist und die große Familie, die er in Wurmlingen gründete, werde ich an anderer Stelle noch ausführlich eingehen.
- Joseph Haug war ein Sonntagskind. Er wurde am 18. Februar 1787 in Haus Nr. 71 in Hirschau geboren und drei Tage später getauft. Seine Paten waren der ledige Johannes Latus und die ebenfalls nicht verheiratete Domitilla Zimmermann. 1788 wurde Joseph gefirmt und später in die württembergische Armee eingezogen. Er war Infanterist und fiel in Napoleons Rußlandfeldzug 1812/13. Er ist auf der Gedenktafel der Hirschauer Gefallenen stehend ganz links zu sehen.
- Peter und Rosina hatten bereits zwei Söhne, als zu Beginn des Revolutionsjahres 1789 ihr dritter Sohn Franz Saless geboren wurde. Er kam Ende Januar 1789 in Haus Nr. 71 Hirschau zur Welt und wurde am Donnerstag, den 29. Januar getauft. Paten waren Johannes Latus und die verheiratete Domitilla Zimmermann. Im Jahr 1800 wurde Franz Saless gefirmt. Franz Saless übte wie sein ältester Bruder Johannes Evangelist das Handwerk des Wagners. In den Jahren 1807 und 1808 hielt er sich nicht in Hirschau auf: Er versuchte vergeblich, sich der Militärpflicht durch Flucht zu entziehen. Doch der junge Mann erlitt dasselbe Schicksal wie sein zwei Jahre älterer Bruder Joseph: zwar war er kein Infanterist, sondern diente im württembergischen Artillerieregiment, doch auch er fiel im Rußlandfeldzug Napoleons. Franz Saless sitzt auf der Gedenktafel für die Hirschauer Gefallenen ganz links.
- Carolus Haug wurde ebenfalls in Haus Nr. 71 geboren und am Dienstag, den 1. November 1791 getauft. Seine Taufzeugen waren Johannes Latus und Domitilla Zimmermännin. Der kleine Karl starb bereits am ersten Weihnachtsfeiertag 1791 – der 25. Dezember war ein Sonntag – im Alter von sieben Wochen an „exu immens Steckfluss“ in Haus Nr. 71 in Hirschau.
- Remigius Haug, geboren in Haus Nr. 71, wurde am Motag, den 1. Oktober 1792 getauft. Auch bei diesem Kind waren Johannes Latus und Domitilla Zimmermännin die Paten. Mit nur sechs Tagen starb Remigius Haug am 7. Oktober (Samstag) desselben Jahres in Haus Nr. 71 in Hirschau „an den Gichtern“ und wurde am Freitag, den 12. Oktober begraben.
- Catharina Haugin kam als letztes Kind von Petrus und Rosina Haug zur Welt. Geboren in Haus Nr. 71, erfolgte am Mittwoch, den 27. November 1793 die Taufe. Wie bei den Kindern zuvor sind Johannes Latus und Domitilla Zimmermännin als Taufpaten genannt.
Katharina Haug starb am Donnerstag, den 1. Januar 1795 im Alter von etwa 13 Monaten in Haus Nr. 71 in Hirschau an „Kaul Fieber“.
Die drei jüngsten Kinder von Peter und Rosina Haug, Carolus, Remigius und Catherina, wurden jeweils etwa im Abstand eines Jahres geboren und starben alle im ersten Lebensjahr. Ihre Mutter Rosina Haug (geb. Knobel) verstarb knapp ein Jahr nach der Geburt der einzigen Tochter mit 29 Jahren am 5. Oktober 1794 in Hirschau, nachdem sie in sieben Jahren sechs Kinder geboren hatte. Nur die drei erstgeborenen Söhne lebten zum Zeitpunkt des Todes der Mutter und waren zwischen 4 und 10 Jahre alt. Der noch junge Witwer Peter Haug heiratete daher etwa zwei Jahre nach dem Tod seiner Ehefrau Rosina mit Anfang Dreißig erneut.
Für die 13 „unschuldigen Schlachtopfer“ aus Hirschau – die Gefallenen waren Joseph Haug, Ignaz Hingher, August Latus, Thomas Haug (* 20. Dezember 1786, Sohn des Johannes Martin Haug und seiner Frau Anna Luzia Hingher), Meinrad Raf (* 22. Januar 1788, Sohn des Xaver Raf und dessen Frau Viktoria Haug), Benedikt Kurz, Hugo Binder, Damasus Friedrich, Franz Saless Haug, Augustin Wohlschieß, Hans Martin Kurz, Hans Martin Weckenmann und Joseph Herrmann – wurde am 1. September ein Jahrtag gestiftet.

Ehrentafel für die gefallenen Hirschauer Hugo Binder, Damasus Friedrich, Franz Saless Haug, Joseph Haug, Thomas Haug, Joseph Herrmann, Ignatz Hingher, Augustin Latus, Hanß Martin Weckenmann, Augustin Wohlschieß, Meinrad Raf, Bendikt Rupp und Hanß Maratin Rupp
Petrus Haug (1762 – 1807) und Margaretha Fuhrer (* 1764)
Peter Haugs zweite Ehefrau wurde, gut zehn Monate nach dem Tod Rosina Knobels, am Montag, den 9. November 1795 die 29jährige Tochter des Wurmlinger Schneiders Xaver Fuhrer und seiner Frau Maria, Margaretha Fuhrer (* Donnerstag, den 1. November 1764). Peter, Bauer und Weingärtner, war zum Zeitpunkt der Hochzeit 29 Jahre alt und die Braut schwanger. Trauzeuge waren der „verhelichte“ Valentin Haug und der Mesmer Eberhard Hemmerle. Mit seiner zweiten Ehefrau bekam Peter noch zwei Söhne[, die aber ebenfalls beide im ersten Lebensjahr verstarben:
- Michael Haug wurde am Freitag, den 26. Februar 1796 getauft; der Säugling ist offenbar mit etwa einem halben Jahr am 15. Oktober 1796 (Samstag) „in Wurmlingen“[ gestorben. Tatsächlich findet sich auch im Wurmlinger Sterbbuch hier ein Eintrag: „den 15. October“ verstarb in Haus Nr. 26 in Wurmlingen oder wohnte in Haus Nr. 26 [in Hirschau] Michael Haug, eheliches Söhnlein des Petrus in Hirschau am aufzehren“
- Knapp neun Jahre später kam im Februar 1805 noch Engelbert Haug zur Welt und wurde am Donnerstag, den 7. Februar getauft. Engelbert starb am 11. Oktober 1806 (Samstag) in Haus Nr. 50 in Hirschau mit gerade einmal elf Monaten am „Hustenfieber“
Der „vereheligte“ Petrus Haug starb knapp 13 Jahre nach dem Tod seiner ersten Frau Rosina Knobel im Alter von 45 Jahren und 8 Monaten am 30. August 1807 in Haus Nr. 50 in Hirschau an „Entzündungsfieber“. Er erlebte daher weder die Hochzeit und Abwanderung seines ältesten Sohnes, noch dass seine beiden anderen Söhne im Franzosenkrieg fielen.
Über das Ableben seiner zweiten Frau Margaretha Fuhrer ist bislang nichts bekannt, doch da Engelbert, das letzte gemeinsame Kind, im Jahr 1805 geboren wurde, ist anzunehmen, dass sich Margaretha mindestens zehn Jahre um die Erziehung und Pflege der drei Stiefsöhne Johannes Evangelist, Joseph und Franz Saless gekümmert hatte. Im Jahre 1810 wird sie unter den Erben ihres Vaters, des Wurmlinger Schneiders Xaver Fuhrer, genannt.
Hirschau war inzwischen seit 1806 württembergisch und hatte etwa 590 Einwohner, darunter 108 Bürger und 8 Witwen. Zwei Jahre zuvor waren es noch 533 gewesen. Das Dorf gehörte nun zum am 1. Januar 1806 gegründeten Königreich Württemberg, das fast während seiner gesamten Existenz im Wesentlichen ein Agrarstaat blieb, in dem mehr als zwei Drittel der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig waren und das als konstitutionelle Monarchie bis 1813 Mitglied des Rheinbundes war.
Außer den Höfen im Ort gab es 2 Schildwirtschaften, 1 Schankwirtschaft, 1 Brauerei und 3 Branttweinbrennereien sowie 29 „Professionisten“ (Einwohner, die einen Beruf erlernt hatten), darunter 21 Handwerker: 3 Bäcker, 2 Hafner, 2 Küfer, 1 Leinenweber, 3 Maurer, 3 Schneider, 1 Schreiner, 2 Schuhmacher und 2 Zimmerleute. 1828 erwähnt die Oberamtsbeschreibung darüber hinaus die Existenz von Steinbrüchen sowie die Kies- und Sandgewinnung; für Schweizer Kaufleute wurde Musselin gestickt. Laut dieser Oberamtsbeschreibung lebten im Ort 827 Einwohner. Hirschau gehörte damit im württembergischen Oberamt Rottenburg zu den größeren Dörfern (mit seiner relativ kleinen Markung rangierte es dagegen in dieser Beziehung im unteren Drittel).
Wurzeln im Schwäbischen – Die Geschichte des Dorfes Wurmlingen
Wurmlingen liegt rund vier Kilometer nordöstlich von Rottenburg, eingebettet zwischen Ammertal und Neckartal, auf einer kleinen Anhöhe zwischen Pfaffenberg und Spitzberg am Fuße der Wurmlinger Kapelle. Früher gehörte noch die unbewohnte Exklave Ammertal zu Wurmlingen, die Nachbarorte Unterjesingen, Hirschau, Rottenburg (Kernstadt) und Wendelsheim grenzen an den Ort. Der niedrige, sattelartige Geländerücken, auf dem der Ort liegt, bildet zwischen dem Spitzberg und dem Pfaffenberg die Wasserscheide zum Ammertal.
Erste Siedlungsspuren
Bei Erdarbeiten wurde 1987 im Neubaugebiet Lindele Ost eine Jägerstation der Neandertaler entdeckt (bis zu 50000 Jahre alte Hornsteinartefakte konnten geborgen werden), und in den 1990er Jahren wurden im Industriegebiet Siebenlinden drei mittelsteinzeitliche Jagdlager ausgegraben. Schon seit Urzeiten scheint die Wurmlinger Gemarkung also Menschen angezogen zu haben und bereits um 1800 v. Chr. bestand auf dem Kapellenberg eine Höhensiedlung.
Besiedelt war der Ort bzw. seine Umgebung auch in der Römerzeit: Auf einem Acker bei der Lehmgrube kamen Werksteine und Schutt römischen Ursprungs zum Vorschein. Auch die römische Hauptstraße war nicht weit entfernt: ursprünglich 4,70 m breit, dammartig gebaut mit einem 40-50 cm starken Steinkörper, gewölbt, mit Kies beschottert (südlich des Arbachs wurde statt Kies Muschelkalk und Grenzdolomit verwendet), gepflastert, meist gerade und zu beiden Seiten mit Graben und Böschung versehen, ist sie nur schlecht erhalten. Heute liegt eine 2 m dicke Bodenschicht auf der alten Römerstraße, von der westlich der Brestnegg eine Zeit jede Spur fehlt, die aber auf der Unterjesinger Gemarkung wieder zum Vorschein kommt. (Vgl. Wurmlingen … es war einmal, S. 7.)
Nördlich des Ortes, zwischen dem Jesinger und Pfäffinger Weg im Gipsbruch, wurden im Jahr 1852 Reihengräber der Alemannen aufgedeckt und wertvolle Funde gemacht, darunter ein 3 Dukaten schwerer goldener Ring, worin eine Münze Kaiser Libius Severus‘ (461 – 465) eingesetzt war, eine goldene Münze Tiberius Constantinus‘ (578 – 582), ein goldener Knopf mit schwarzem Schmelz, ein Kreuz bildend und Riemzeug mit vergoldeten Nägeln sowie ein vergoldeter Schwertgriff. Auch Pferdereste wurden ausgegraben.
Spuren der Besiedlung des Ortes stellen auch die zwei fränkischen Gräberfelder aus dem 7. Jahrhundert nach Christus dar.
Die Ansiedlung Wurmlingen war im Mittelalter zunächst ein unplanmäßig angelegtes Haufendorf aus zwei Siedlungskern.
Der Ortsname – Entstehung und Bedeutung
Ein geschichtlicher Zusammenhang zu Wurmlingen bei Tuttlingen war lange nicht nachzuweisen, eine Urkunde deutet jedoch auf eine Verbindung hin: Die Brüder Albert, Friederich und Heinrich (genannt die Hohin), Herren von Wurmlingen bei Tuttlingen und Burg Wurmlingen und Ministerialen der Grafen von Zollern, verkauften am 7. Dezember 1252 ihren Weinberg im Pfaffenberg (Kapellenberg) mit Zustimmung ihres Herrn, des Grafen Friedrich von Zollern, an das Frauenkloster Kirchberg.
Es gibt viele unterschiedliche Schreibweisen für den Heimatort meines Vaters: Wormelingen, Wurmeringen Wurmlingen, Wrmelingen, Wrmelingin, Wurmlingin, Wurmelingen, Wrimlingin, Wurmelingin, Wurmlingen (1110). Wahrscheinlich erinnert der Name des Dorfes an die Volkssage von der Erlegung eines Lindwurms (Drache) an der Wandelburg am Fuße des Wurmlinger Bergs (monte vermicularis) und im Schwärzloch im Ammertal, der dort gelebt haben soll. Heute steht hier nur noch ein alter Herrenhof und eine ehemalige, aus der Romanik stammenden Kirche, das einst dazu gehörende Dorf existiert nicht mehr, da die Schwärzlocher aufgrund der Nähe zu Tübingen, das mit Freiheit und wirtschaftlich interessanteren Betätigungen lockte, wegzogen, denn im Ammertal war die Arbeit hart, auch wenn Wein- und Obstbau für viele ein Auskommen boten. Trotzdem konnten sich die Ärmsten der Armen oftmals nur durch den Abbau von Steinen vor dem Hungertod retten.
Heute erinnert an die Legende vom Lindwurm das Fassadenbild der Dorfpfarrkirche St. Briccius, das den Erzengel Michael als Drachentöter zeigt. Die Dorfkirche wird erstmals als Kapelle im Jahre 1466 genannt, deren Patron St. Briccius 1485. Seit dem 16. Jahrhundert war sie de facto Pfarrkirche, formell jedoch erst seit 1780. Bis dahin war die 1213 urkundlich genannte Bergkapelle St. Remigius Pfarrkirche. Remigius von Reims (* vermutlich 436; † 533) war ein aus gallo-römischem Adel stammender Bischof im Osten des heutigen Frankreichs, der durch die Taufe des Merowingerkönigs Chlodwig I. bekannt wurde und als einer der großen Heiligen des fränkischen Volkes verehrt wird.
„Der Wurmliger Schultheiß und Chronist Anton Birlinger berichtet 1775, dass im Frühjahr desselben Jahres der Kirchturm kurz vor dem Einstürzen war. Die Gemeinde beantragte beim Oberamt in Rottenburg, den Glockenturm wieder aufbauen zu lassen und gleichzeitig die Kapelle zur Pfarrkirche zu machen. Der alte Glockenturm wurde im Jahr darauf vollständig abgerissen und durch einen neuen ersetzt, weitere vier Jahre später wurde aus der Kapelle offiziell eine Pfarrkirche.“ (Frahm, Die Chronik des Schultheißen Birlinger (1770 – 1796), S. 106.)
Tatsächlich wird der Ortsname Wurmlingen von einem Personennamen (Wormero, Wurmeking oder Wurmilo) abgeleitet. Er taucht zum ersten Mal im Hirsauer Schenkungsbuch um 1090 auf. Um 1120 wird Wurmlingen ebenfalls urkundlich erwähnt – der Adlige Heinrich von Wurmlingen war Klosterbruder in Hirsau. Die Burg im Dorf gehörte den Märheld von Wurmlingen. Die Familien Märheld, von Mörsperg und von Steinhilben waren Zweige des um 1120 genannten Ortsadels (die Rottenburger Linie der Märheld existierte von 1292 bis 1519 und stellte dort mehrere Schultheißen).
Die (Wasser)Burg zu Wurmlingen wurde von den Ammann erbaut, besessen und bewohnt und stand hinter dem Gasthof Rössle im Brestenegg. Wohl im 13. Jahrhundert entstand im Bereich der Kirche, wo eine Feste des Wasserschlosses stand, ein zweiter alter Teil Wurmlingens. Das um 1400 genannte und Ende des 18. Jahrhundert abgegangene Wasserschloss (Vest) kam über die Geschlechter der von Ow, die Megenzer von Felldorf (1478) und die Freiherren von Hohenberg (1675) schließlich 1731 – 1762 an die von Rost.
Ortsherrschaft und Landesherrschaft
Als Grund- oder Lehnsherrschaft (Feudalismus) wird die besonders in Südwestdeutschland bis ins 19. Jahrhundert übliche mittelalterliche Form des Großgrundbesitzes, bei der der Grundherr oder sein Verwalter (Meier) von einem oder mehreren Fronhöfen (Verwaltungsmittelpunkten) aus einen kleinen Teil des Grundbesitzes selbst bewirtschaftete, bezeichnet. Der größere Teil der Ländereien war zu einer eigentumsähnlichen Nutzung (Landleihe) an abhängige Bauern vergeben, die dafür Abgaben und Frondienste zu leisten hatten. Dem Grundherrn stand die Gerichtsbarkeit zu.
Wurmlingen gehörte seit 1381 zu Vorderösterreich, war später im Besitz der Grafen von Hohenberg und blieb bis 1762 an diese Freiherren (und die Herren von Raßler) verpfändet. Die Grafen von Hohenberg und ihre Nachfolger, die Herzöge von Österreich, übten mit Hilfe von Amtsleuten die Vogtei und Gerichtsherrschaft über die hohenbergischen Dörfer aus. Oberster Beamter war zunächst der Rottenburger Vogt, der später durch einen so genannten Hauptmann ersetzt wurde.
Im 18. Jahrhundert führte dieser schließlich die Amtsbezeichnung Landvogt, dem wiederum für bestimmte Aufgaben der Marschall, der für die Erfassung und Verrechnung der landesherrlichen Einkünfte zuständige Landschreiber sowie zu dessen Kontrolle der Gegenschreiber unterstanden. Als Vogtherrschaft bezog Österreich von Wurmlingen gewisse Vogteiabgaben und hatte darüber hinaus Anspruch auf Frondienste. Genau nachweisen lassen sich die fixen und veränderlichen Abgaben Wurmlingens in den herrschaftlichen Jahresrechnungen, die, beginnend im Jahr 1392/93, zwar nur lückenhaft erhalten sind, aber zeigen, dass Wurmlingen eine jährliche Geldsteuer und eine Getreidesteuer (Vogthaber) in Höhe von 20 lb., hl. und 20 Malter Hafer zu entrichten hatte. Das Malter ist ein Volumenmaß und wurde als Getreidemaß genutzt, war aber in jeder Region, jeder Stadt und jedem Dorf unterschiedlich, es gab gar das große und kleine Malter. Das Maß war auch von der Getreideart bestimmt und wurde gehäuft oder gestrichen verwendet. Es gab das Hafermalter, das für glatte oder rauhe Frucht verwendet wurde. In Wurmlingen bzw. Rottenburg betrug 1 Malter für Dinkel oder Hafer = 193,16 l, für Roggen betrug 1 Malter = 181,19 l.
Doch nicht nur die Gemeinde, auch die einzelnen Einwohner waren mit Vogteiabgaben belegt: Laut dem Lagerbuch von 1471 hatte jedes „Gehusit“ jährlich ein Grashuhn (ein Zinshuhn, das dem Grundherren eines Holzes oder eines Grasplatzes für den Gebrauch des Grases gegeben wurde), ein Herbsthuhn (ein (junges) Huhn, das jede Haushaltung oder Hofstätte oder sonstiger Leihgrund als grundherrliche Abgabe leisten musste) sowie eine Fasnachtshenne zu entrichten. Leibeigene mussten jährlich vor der Fastenzeit als Zeichen der Anerkennung ihrer Leibeigenschaft ein Fastnachtshuhn an ihren Leibherrn entrichten, der ihnen juristischen Schutz gewährte (ihnen z.B. bei einer Ladung vor ein fremdes Gericht einen Rechtsbeistand stellte).
Später wurde diese Regelung dahin abgeändert, dass „jedes Ehegemächt“ (also jeder Ehepartner) sowie jeder Witwer und jede Witwe abgabepflichtig waren, während der Schultheiß und der Gerichtsknecht sowie die „Kindbetterinnen“ befreit waren. Außerdem wurden die Abgaben nicht mehr in Naturalien, sondern in Geld geleistet: seit 1729 für eine Henne 10 kr. und für ein Maien- und Herbsthuhn je 5 kr. Nach der Rentamtsrechnung von 1757 machten die Hühnerabgaben in Wurmlingen bei 107 Haushaltungen unter Berücksichtigung der Befreiungen immerhin 34 fl. 10 kr. aus.
Eine weitere Belastung der Einwohner bildete das Hauptrecht bzw. der Hauptfall, also der dem Lehnsherrn zustehende Anteil am Nachlaß persönlich oder dinglich Abhängiger. Diese Abgabe des besten Viehes, Gewandes und dergleichen an den Grundherren musste beim Tode des Leibeigenen oder Abhängigen geleistet werden, beim Tod einer Frau das beste Kleid.
Wie die hohenbergischen Jahresrechnungen seit dem Ende des 14. Jahrhunderts zeigen, wurden in der Grafschaft alle Untertanen „verhauptrechtet“, wobei ein bestimmter Anteil des hinterlassenen Vermögens zum Einzug kam. Bis zur Neuordnung von 1579 betrug das Hauptrecht 1 fl. von 100 fl. Hinterlassenschaft bei den Männern (also 1 Prozent), bei den Frauen nur 1 lb. hl. (oder 38 ½ kr.).
Nach einer 1756 angestellten Berechnung betrug das Hauptrecht in Wurmlingen in sieben vorausgegangenen Jahren im Durchschnitt 31 fl. Eine sehr einträgliche Einnahmequelle für die Herrschaft waren die Strafgelder (Frevel), zumal die Gemeinden die Feld- und Waldfrevel ahnden durften. Nach den ältesten hohenbergischen Rechnungen lagen die einzelnen Frevel bei 1 lb. oder 2 lb., gelegentlich kamen auch höhere Beträge bis zu 10 lb. vor.
Seit 1555 betrug der kleine Frevel laut Frevelordnung 2 fl., der große Frevel (oder Blutfrevel) 10 fI., während Friedbruch mit 20 fl. geahndet wurde. Weitere Strafbestimmungen enthielt die niederhohenbergische Landesordnung, die beispielsweise für den Ehebruch eine Strafe von 20 fl. vorsah.
1556 wurde Maxime Rid, Vikar auf dem Wurmlinger Berg, ins Gefängnis zu Stuttgart eingeliefert, weil er im württembergischen Forst Wild erlegt und von anderen geschossenes Wild gekauft hatte. [Auf] sein und seiner Freunde Bitten [wurde er offenbar] begnadigt und mit der Auflage entlassen, seine Gefängnissatzung und alle Unkosten zu bezahlen, sich künftig jeglichen Waidwerks zu enthalten, keine Büchse zu gebrauchen sowie keinen Hund in den Wald und an andere verdächtige Orte zu führen. Er gelobte eidlich, diese Bestimmungen zu halten. (Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Hauptstaatsarchiv Stuttgart, A 44 U 5622 (Kontext: Urfehden Band 10: Sulz – Tuttlingen, Stadt/Amt/Vogtei/Forst)
Nicht nur beim Tod, auch beim Wegzug eines Untertanen in eine andere Herrschaft wurde eine Gebühr („Abzug“) fällig: Jeder, der aus der Grafschaft Hohenberg auswanderte, hatte 10 Prozent des abziehenden Vermögens zu entrichten. Weitere herrschaftliche Regalien waren der Zoll und das Umgeld. Außerdem musste jeder Wirt laut der Maximilianischen Reformationsordi aus dem Jahr 1608 bei Ausschank von Wein die 13. Maß als Umgeld abzuführen.
Die Wurmlinger Dorfbewohner waren nicht nur mit Abgaben und Gebühren belastet, sondern hatten auch Frondienste für die Herrschaft zu leisten: Nach Ausweis des Lagerbuchs von 1620 waren sie verpflichtet, die nötigen Baumaterialien, die herrschaftlichen Mühlen und Keltern, ebenso das Brennholz zum Rottenburger Schloss zu führen. Dabei hatten die Pferdebesitzer mit Wagen und Karren zu fronen, während die übrigen Leibfron leisteten, wofür sie als Gegenleistung die „Lieferung“ bekamen, d.h. Futter für die Pferde und Essen für die Menschen.
Speziell für Wurmlingen (und Hirschau) galt die Verpflichtung zu Frondiensten für die 12 „Mannsmahd“ großen Herrschaftswiesen „auf dem Burkenlay“, wofür aber Lohn gezahlt wurde.
Nach dem Rückfall an Österreich 1749 galten wieder die alten Verhältnisse, die nun allerdings in Geld zu entrichten waren: Danach bezahlte jeder Pferde- oder Ochsenbesitzer 10 kr., jeder Tagelöhner oder Söldner 6 kr. und jeder Witwe 3 kr. Siebzehn Jahre später (1766) betrug das durchschnittliche Frongeld jährlich 16 fl.
Eine besondere Abgabe war mit der Wurmlinger Backküche verbunden: laut dem Herrschaftslagerbuch von 1620 betrug der jährliche Backküchenzins einen Frischling oder 2 fl.
Wie in zahlreichen anderen Orten, so war auch in Wurmlingen der Zehnte zwischen dem Ortspfarrer und der Herrschaft aufgeteilt (wobei das Kloster Kreuzlingen den Pfarrer vertrat). Dem Herrschaftslagerbuch von 1620 kann man entnehmen, dass die Hohenberger Herrschaft und das Kreuzlinger Kloster sowohl den Großzehnten als auch den Weinzehnt je zur Hälfte bezogen. Der Wurmlinger Pfarrer bezog den Heu-, Klein- und Blutzehnten.
Das Steuerbereitungsprotokoll von 1681 verzeichnet für Wurmlingen 84 „Kontribuenten“, allerdings befanden sich unter den Steuerzahlern 13 Witwen und Waisen, weshalb es auch nur 69 Wohnhäuser gab, darunter viele schlechte und ruinöse, außerdem waren im Jahr zuvor 39 Pferde, 110 Rindviecher und 170 Schafe gezählt worden. Über die Bevölkerungsstruktur wurde 1681 folgende Angabe gemacht: „Allda seyn kheine gantz noch halbe Paurn, gleichwie in andern Herrschaftsfleggen, sondern die, so Roß haben, werden von Pauren, die andere aber vor Daglöhner oder Söldner gehalten, und befinden sich darunder Handtwerkhsleuth und 20 Persohnen, so Roß haben, die übrige seyn lauther arme Daglöhner und Weingärtner.“ Die 20 Pferdebesitzer konnten insgesamt 17 Pflüge ins Feld führen. Die Handwerkerschaft belief sich auf acht Personen, darunter 2 Bäcker und je 1 Schmied, Metzger, Zimmermann, Wagner, Weber und Küfer. Die Armut drückte sich zu Beginn der 1680er Jahre auch darin aus, dass die Gemeinde 8105 fl. Schulden zu verzeichnen hatte. (Müller, S. 90.) Im Jahre 1680 gab es in Wurmlingen 67 Wohnstätten. (900 Jahre Wurmlingen, S. 429.)
Ablösung der Grundherrschaft
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfolgte die Ablösung der Grundherrschaft: 1836 wurden erste Fronen und Lasten aufgehoben. Zur Zehntablösung kam es im Rahmen der Re-volutionsgesetzgebung erst 1848/49, an die sich Beseitigung aller lehensrechtlichen Bindungen sowie aller damit verbundenen Abgaben und Pflichten anschloss. Bis dahin gestalteten sich die Zehntverhältnisse in Wurmlingen wie folgt: Vom Groß– bzw. Fruchtzehnt erhielt der württembergische Staat 5/6 und 1/6 die Universität Freiburg. Für den Dinkelzehnt bestand eine Sonderregelung: der Staat erhielt eine Hälfte (früher Kloster Kreuzlingen), von der anderen Hälfte (früher Österreich) bekam 2/3 Württemberg und 1/3 die Universität Freiburg. Der auf den Ertrag von „Erdbirnen“ (Kartoffeln), Klee, „Reps“ (Raps), Hanf und Kraut erhobene Kleinzehnt ging ebenso wie der von den „der Amtsstadt Rottenburg zu liegen[den]“ Wiesen erhobene „Heu- und „Ohmdzehnt“ („Ohmd“: Gras des zweiten Schnitts) je hälftig an Württemberg und die Universität Freiburg. (StAR C 170, B 48 (Gemeindegüterbuch 1837 – 1840)) Den Weinzehnt (auch: Weingefallen) erhielt in erster Linie Württemberg (teils ganz, teils 5/6 oder 8/9), der Rest stand wiederum der Universität Freiburg zu. Folgende Institutionen bezogen daneben Reallasten, die sogenannten Gefälle, aus Wurmlingen: das Kameralamt Rottenburg, die Hospitalpflege Rottenburg, die Heiligenpflegen Wurmlingen und Wendelsheim, die Pfarreien Wurmlingen, Wendelsheim und Unterjesingen, die St. Lorenz- und die Sülchenkaplanei Rottenburg, der Besitzer des Kohlerschen Lehens von Ofterdingen und der Besitzer des Ammerhofguts. (StAR C 170, B 48 (Gemeindegüterbuch 1837 – 1840) und B 102 (Gefällablösevertrag 1852 – 1858); s. OABRott1, S. 109.)
Weinbau und Landwirtschaft
Ein wichtiger Zweig der Landwirtschaft war in Wurmlingen der Weinbau (bereits um 1100 erwähnt). Im Ort gab es fünf Keltern. Der Haupterwerb bestand jedoch im Ackerbau, der in der üblichen Dreifelderwirtschaft (Winter-, Sommerfrucht und Brache). Die Gülten, ein gewisses jährliches Einkommen, besonders von Grundstücken, in engerer Bedeuung des Wortes ein Pachtzins, den ein Pächter dem Grundherren für den Nießbrauch (Nutzung) des ihm übertragenen Grundstückes zu entrichten hatte, und die Zehnterträge zeigen, dass der Rottenburger Raum im Spätmittelalter ein Roggenanbaugebiet war und Dinkel oder Vesen erst später zur Hauptfrucht wurden. Auch Hafer wurde bereits angebaut, während Gerste erst im 18. Jahrhunde aufkam. (Müller, S. 92.)
Im 19. Jahrhundert war in Wurmlingen das als Wintergetreide angebaute schwäbische Korn (Dinkel) zur Hauptbrotfrucht geworden: „Der Dinkel ist beliebter als eigentlicher Weizen wegen seiner größeren Genügsamkeit mit dem Boden, der Feldbestellung und den Vorfrüchten, sowie weil er sichere Erträge liefert, leichter auszudreschen und aufzubewahren und dem Vogelfraße nicht ausgesetzt ist.“ (Die Landwirtschaft in Württemberg. Denkschrift, Stuttgart 1902, S. 147.) Besonders beliebt war der rote Tiroler Dinkel, aber auch weißer und blauer Dinkel wurde angebaut: „Der Körnerertrag ist beim Weizen etwas größer als beim Spelz [Dinkel], dafür aber wird das Mehl der Dinkelkörner [Kernen] von den Bäckern vorgezogen und die dickeren Häute der Weizenkörner werden getadelt.“ (Erath, Das Obermat Rotenburg, S. 26.) Als Sommergetreide wurden Gerste (vorwiegend als Braugerste genutzt) und etwas Hafer angebaut, aus denen auch Mus und Brei als Zubrot bereitet werden konnte. Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts wurden außerdem Kartoffeln angebaut, welche außer als „menschliches Nahrungsmittel“ als Schweinefutter und für die „Branntweinbrennerei“ verwendet wurde. Der gleichzeitig eingeführte Anbau der Brache mit Futterpflanzen (Klee, Luzerne (auch Alfalfa, Schneckenklee oder Ewiger Klee); eine Hülsenfrucht, die als Futterpflanze für Pferde und Schafe verwendet wird), Esparsette (auch Süßklee oder Gesundes Heu); eine mit der Erbse verwandte Hülsenfrucht, die als Futterpflanzen für Nutztiere, vor allem schwer arbeitende Pferde verwendet wird), Wicken oder Rüben) ermöglichte die Stallfütterung des Viehs, das nun nicht mehr auf die Gemeindeweide getrieben wurde. Doch die Produktionsweise insgesamt – die Äcker waren (durch Realteilung und Dreifelderwirtschaft) doppelt zersplittert und die Arbeitsweise einfach, von Hand (mit Sichel und Hacke, später mit Sense und Pflug) und mit Arbeitsgeräten, die vielfach aus Holz waren – wurde nicht modernisiert.
Vergleicht man die Anbaustatistik der Jahre 1895 und 1933 so zeigt sich, dass der Anbau von Brotgetreide (Dinkel, kaum Weizen und wenig Roggen) sowie von Handelsgewächsen (Hopfen, wenig Hanf und Raps) auf etwa die Hälfte zurückging. Der Anbau von Gerste und Hülsenfrüchten (Erbsen, Linsen, Bohnen) blieb in etwa gleich, dagegen nahm der von Anbau Hackfrüchten (Kartoffeln, Rüben, Kopfkohl (Weißkohl, Rotkohl, Spitzkohl und Wirsing)) und besonders von Futterpflanzen für das Vieh deutlich zu. Auch in den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts blieb der Anbau von Brotgetreide auf der Wurmlinger Markung dominierend, wobei nun zunehmend Weizen angebaut wurde, der den Dinkel allmählich zurückdrängte.
Bereits im Lauf des 18. Jahrhunderts hatte die durchschnittliche Größe der Höfe zwar deutlich abgenommen, gleichzeitig kam es Ende des Jahrhunderts aber auch zur Intensivierung des Anbaus durch eine Verbesserung des Betriebssystems (Teilanbau der Brache mit Klee, Luzerne und Kartoffeln) und durch die Einführung verbesserter Düngermethoden. Die Steuerbereitung von 1681 bietet die erste Übersicht über die Bodennutzung, nach der auf der Wurmlinger Markung 509 Jauchert als Ackerland, 174 Mannsmahd als Wiesen und Gärten und 94 J (141 Morgen) als Weingärten dienten. Ein Jauchert (lat. jugerum; auch Joch oder Mannsmahd) entspricht 1 ½ Morgen (= 42,27 a). (Verdenhalven, Alte Meß- und Währungssysteme.) Das Joch ist die Fläche, die von einem Ochsen beziehungsweise einem Ochsengespann an einem einzigen Tag gepflügt werden kann. Abhängig von den regionalen Bodengegebenheiten liegt dieser Wert zwischen.
Die Gemeinde hatte offenbar keinen „Trieb oder Weidgang“, weshalb die Kühe und Schafe in den Ställen und auf der Brache und den „Stupflenäckern“ gehalten wurden. (Müller, S. 92.)
Neben 39 Pferden gab es im Jahr 1681 in Wurmlingen 110 Stück Vieh (wohl Ochsen) sowie 170 Schafe. Offenbar lagen damals noch manche Felder wüst, denn die nächste Steueraufnahme (1725) zeigt eine beträchtliche Zunahme bei den Äckern (573 Jauchert) und Weingärten (133 Jauchert). Zu diesem Zeitpunkt lebten 101 Bürger im Ort. 40 Jahre später (1765) sei die Qualität der Reben sehr schlecht gewesen, und da sie fast jedes Jahr sowohl im Frühling als auch im Herbst von der „Gefröhrnus“ betroffen seien, würde sich „öfter die Mühe und Arbeith nit bezahlen“. Im Gegensatz zur Ausweitung der Wirtschaftsfläche war beim Viehbestand ein Rückgang zu verzeichnen, da nur 28 Pferde und 67 Kühe registriert wurden. Daneben standen in den Ställen noch 46 Kühe, die als Stell- oder Mistvieh auswärtigen Besitzern gehörten. (Müller, S. 93.) Ende des 18. Jahrhunderts nahm der Rindviehbestand beträchtlich zu, was auch für die Schweinehaltung anzunehmen ist, während die Schafhaltung zurückging. (Müller, S. 94f.) 1772 gab es im Ort 32 Ochsen und 195 Kühe, 1.804 48 Ochsen, 165 Kühe, 70 Stück Jungvieh und 50 Kälber. Daneben 145 Gänse, 30 Enten, 1.135 Hühner und 230 Tauben – und 38 Bienenstöcke. Es gab 98 Häuser im Ort, in denen 503 Einwohner lebten, von denen wiederum 98 Bürger waren. Die landwirtschaftliche Nutzfläche verteilte sich 1718 laut Feldmesser Thanner folgendermaßen auf die Einwohner: es gab 136 einheimische Grundbesitzer, die im Durchschnitt sechs Jauchert besaßen. Der größte Bauer, Michael Theyrer, besaß allerdings 33 Jauchert. Der Fruchtzehnt wurde in Wurmlingen auf Getreide, Hülsenfrüchte und Kartoffeln erhoben, darüber hinaus gab es den Einzehnten, den Heuzehnten und den Blutzehnt (Abgabe vom Viehbestand). Hinsichtlich der Größe der landwirtschaftlichen Betriebe fällt die Dominanz von sogenannten Parzellenbetrieben (bis 2 ha) und kleinbäuerlichen Betrieben (2 bis 5 ha) auf; größere bäuerliche Betriebe (über 10 ha) gab es in Wurmlingen im 19. Jahrhundert aufgrund der Realteilung nicht mehr, und mittelbäuerlichen Betriebe (5 bis 10 ha) bildeten nur knapp 10 Prozent der Gesamtzahl. (OABRott2 (1900), Anhang S. 30f.) 1771 hatte der Ort 504 Einwohner (verteilt auf 98 Haushaltungen), 1803 waren es bei 119 Häusern 774 Einwohner (davon 423 weiblich). 1933 gab es 228 Haushaltungen, von denen 213 auch als landwirtschaftliche Betriebe registriert waren. Bei einer bis etwa zur Mitte des 19. Jahrhunderts ständig steigenden Bevölkerungszahl wurde es schwieriger, sein Auskommen allein durch die landwirtschaftlichen Erträge zu sichern, denn die Höfe wurden aufgrund des geltenden Erbrechts immer kleiner. Die oft schon nach wenigen Generationen erreichte extreme Güterzersplitterung, die nicht nur den Grundbesitz, sondern teilweise auch die Häuser und Hofraiten (= der von den Gebäuden eines Gehöfts umschlossene Hofraum, respektive der um den Hof liegende Raum, die Hofstelle, mit Bauernhaus und Nebengebäuden) erfasste, führte in vielen Fällen zu einer gravierenden Reduzierung der Betriebsgrößen, die schließlich selbst bei intensiver Nutzung der Wirtschaftsflächen kaum das Existenzminimum gewährleistete. Hinderlich für eine rationelle Landwirtschaft war auch die starke Parzellierung der Markungsfläche. 1896 gab es 2.892 Ackerparzellen und 915 Wiesenparzellen, die Durchschnittsgröße einer Ackerparzelle betrug rund 7,2 Ar, die einer Wiesenparzelle rund 3,1 Ar, und da es fast keine Feldwege gab, mussten nahezu alle Äcker über den Besitz von anderen erreicht werden. Die Oberamtsbeschreibung des Ortes von 1828 lautet denn auch: „Die Lage des Orts ist sehr angenehm und gewährt reizende Aussichten, besonders reich sind Aus- und Fernsichten auf dem kegelförmig erhöhten Berge, mit einer Kapelle und Gottesacker um sie. Die Gegend liegt wie eine ungeheure Landkarte, in der die Grenzlinien der Feldungen nicht nur, sondern selbst einzelner Grundstücke unterschieden werden können, im Neckar- und Ammertale ausgebreitet vor den Augen, während die umliegenden Berge weithin in die Ferne sich plastisch erheben, und zuletzt sich in blauen Duft verschwimmend verlieren.“ (OABRott2 (1900), Anhang S. 22f.) Wohl bereits im Zusammenhang mit der mittelalterlichen Gewannenflur waren diese Feldstreifen entstanden, bei der jeder Bauer Streifen verschiedener Felder bewirtschaftete und sich die Lage derselben auch immer wieder änderte. (Wurmlingen … es war einmal, S. 7.)
Die Bevölkerung
Im 16. und 17. Jahrhundert war Wurmlingen (neben Hirschau) das bevölkerungsreichste Dorf in Niederhohenberg. Der intensive Weinbau war dafür zweifelsohne mitverantwortlich. Der Anbau von Wein ist in Wurmlingen seit dem Ende des 11. Jahrhunderts bezeugt und der Ort galt neben Hirschau bereits im Spätmittelalter als einer der bedeutendsten Weinorte der Herrschaft Hohenberg.
Die Anbaufläche betrug im 16. Jahrhundert über 150 Morgen, weshalb es im Ort drei Keltern gab. Schon in der hohenbergischen Steuerliste von 1394 wurden 69 Wurmlinger „Kontribuenten“ (Steuerzahler) mit einem Gesamtvermögen von 4221 lb. hl. genannt. Erstaunlicherweise war die reichste Einwohnerin mit Uot der Goussoltin eine Frau, die über ein Vermögen von 380 lb. hl. verfügte.
1681 wurden im Dorf sogar 84 „Kontribuenten“ und 67 Wohnungen gezählt. Im Lagerbuch von 1471 wurden für Wurmlingen 62 Herdstätten angegeben, 1557 gab es 74 Hausgesäße.
Laut dem Musterungsregister von 1581 zählte man 93 wehrfähige Männer im Ort. Die Dorfbewohner waren mit hinreichend Waffen ausgerüstet und stellten nach Hirschau das größte Kontingent. 1581 gliederten sich die Bewaffneten in 26 Schützen, 25 Mann mit Rüstungen und 42 Halbgerüstete, 1615 bezeugt das Musterungsregister 63 wehrfähige Männer, darunter 26 mit Musketen bewaffnet, 5 mit Haken, 15 mit Hellebarden und 17 mit Rüstungen und Spießen. Außerdem gab es 2 Pfeifer, 2 Trommler und 16 unbewaffnete Männer.
Zusätzlich werden noch 10 Pferdebesitzer aufgeführt, die offenbar nicht mehr wehrpflichtig waren, darunter ein Wirt. 62 Personen besaßen ein Vermögen von insgesamt 26062 lb. fl. – zwei Personen besaßen jeweils 2000 lb. fl. Im Vergleich zu anderen Dörfern war aber in Wurmlingen der Anteil der Armen sehr hoch, denn 27 Wurmlinger hatten ein Vermögen von weniger als 20 lb. hl. (1 fl. = 1,71 Mark).
Da es in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in der Grafschaft Hohenberg zu einem Bevölkerungswachstum, warben die österreichischen Behörden um Abwanderung und es kam zu mehreren Auswanderungswellen nach Osteuropa: aus Wurmlingen wanderten z.B. rund 50 Erwachsene ins ungarische Banat ab. Nach einer Erhebung aus dem Jahr 1765 hatte Wurmlingen damals 106 Bürger (darunter 36 Zugfroner und 70 Handfroner). Drei Jahre später wurde eine Feuerversicherung eingeführt, weshalb die Wurmlinger Häuser gezählt und 100 registriert wurden, in denen 120 Familien lebten. Die Zahl der Wohnstätten war also in nicht einmal 100 Jahren um 23 gestiegen. Damals gab es im Ort ein Gemeindehaus und ein Wirtshaus. (900 Jahre Wurmlingen, S. 92) Die Einwohner mussten nach wie vor die unterschiedlichsten Frondienste verrichten und Lehensabgaben leisten. Die Abgaben wurden oft als drückend empfunden, besonders nach schlechten Erntejahren. 1767 ersuchten beispielseise Johann Weiß und andere Wurmlinger bei der ober- und vorderösterreichische Regierung der Grafschaft Hohenberg um die „Herabsetzung der Landgarbe aus den Weinbergen zu Wurmlingen vom 3. auf den 6. Teil“ (https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/druckansicht.php?id_titlaufn=2614163&bestand=3733 (29.04.2017))
Dorf und Gemeinde
Das bäuerlich geprägte Leben spiegelte sich in den Wurmlinger Häusern, in denen im Durchschnitt sechs Menschen in einem typischen Einhaus lebten, das alle notwendigen Funktionen unter einem Dach vereinte. Im Obergeschoß gab es wenige Wohnräume: neben der Küche das beheizbare Wohnzimmer über dem (warmen) Stall für das Vieh, dahinter die Kammer, einen Gang und den Abtritt (Abort). Die Scheune und der Schopf dienten zur Lagerung der Frucht- und Heuvorräte sowie zur Aufbewahrung der landwirtschaftlichen Fahrzeuge und Gerätschaften. Der Keller war meist durch eine Falltür vom Hauseingang oder der Scheune aus zu betreten.
Seit dem 15. Jahrhundert gab es im Ort ein Gericht, das für rechtliche Entscheidungen zuständig war. Alle Urkunden und Dokumente der Einwohner (Kaufverträge, Schuldverschreibungen, Heiratsverträge etc.) wurden vom Landschreiber ausgefertigt und ins Kontraktenbuch eingetragen. Spätestens 1751 wurden die Dorfgerichte im vorderösterreichischen Hohenberg abgeschafft und ihre Aufgaben an zwei Deputierte übertragen. (Frahm, Die Chronik des Schultheißen Birlinger (1770 – 1796), S. 103.) In Wurmlingen gab es allerdings weiterhin sechs Richter, die vom Gemeinderat bestimmt wurden. (Frahm, Die Chronik des Schultheißen Birlinger (1770 – 1796), S. 103.) Im Jahr 1722 wird erstmals ein Rathaus im Ort erwähnt. Als Amtmann hatten die Hohenberger einen Schultheißen eingesetzt, der als Ortsvorsteher auch die Bauernschaft vertrat; in Wurmlingen wird ein Schultheiß erstmals 1343 als Zeuge einer Urkunde erwähnt. Gleichzeitig war der Schultheiß Vorsitzender des Dorfgerichts, das „kleinere Vergehen und Übertretungen [strafte … und außerdem] die üblichen Rechtsgeschäfte wie Teilungen, Verkaufstkontrakte, Eheverträge und dergleichen“ erledigte. (Frahm zitiert hier aus Eugen Stemmlers Monographie ‚Die Grafschaft Hohenberg‘, ohne die Quelle genau anzugeben. Vgl. Frahm, Die Chronik des Schultheißen Birlinger (1770 – 1796), S. 103.) Seit 1750 durften die volljährigen männlichen Wurmlinger drei Kandidaten für das Amt des Schultheißen auswählen. Einmal gewählt, übte der das Amt lebenslang aus. Die Voraussetzung, die die Kandidaten erfüllen mussten, war das Mindestalter von 25 Jahren. Das Oberamt allerdings entschied sich dann für den fähigsten Kandidaten, der jährlich mit 5 fl. entlohnt wurde und in Kriegszeiten das Doppelte bekam. Ihm zur Seite standen zwei Deputierte aus der Gemeinde (diese wurden mit 2 fl. jährlich besoldet). Die bisherigen Dorfgerichte wurden nun aufgehoben. (Wurmlingen … es war einmal, S. 96f.) In Wurmlingen gab es auch seit mindestens 1763 eine Freiwillige Feuerwehr. Für dieses Jahr ist die Lieferung einer Feurspritze durch die Firma Kurtz aus Reutlingen belegt. Allerdings ist über Aussehen und Verbleib derselben nichts bekannt. 1860 erhielt die Freiwillige Feuerwehr eine neue Feuerspritze von Carl Ackermann aus Eutingen. (Freiwillige Feuerwehr in Wurmlingen. In: Karlheinz Geppert (Hg.): 900 Jahre Wurmlingen – Vom Dorf am Fuße der Kapelle. Rottenburg am Neckar und Wurmlingen 2000, S. 358.)
Im Jahre 1772 wurde Anton Birlinger Schultheiß in Wurmlingen. Er übte dieses Amt bis 1798 aus und verfasste eine Chronik, die ein Vierteljahrhundert Ortsgeschichte beleuchtet und den Zeitraum von 1770 bis 1798 umfasst. (Der Text ist unter der Signatur cod. poet. Et philol. 77.C.1 – 13 ungesz. Bl., 2° in der Handschriftenabteilung der Stuttgarter Landesbibliothek archiviert.) So geht Birlinger zunächst auf die veränderte, seiner Meinung nach ungerechte Besteuerung des Ortes ein und verglich diese mit der einer – größeren – Nachbargemeinde: „Anno 1770 wurde in dem ganzen Niederhochbergischen Bezirck ein Neuer Perequations oder Steur Fuß ein gerichtet, wobey die Gemeind Wurmlinge viellen Schaden und Ohnkosten zu leiden gehabt. Indem nach geendigtem Geschäffte der Gemeind Wurmlingen als ein Ordinarius Abgaab summa 440 fl. 70 cr. Folglich 55 fl. mehr als der so starken und in den vormahligen Solden immerhin höher angesezten Gemeind Ergenzingen.“ (Zitiert nach Frahm, Die Chronik des Schultheißen Birlinger (1770 – 1796), S. 104.) Im darauffolgenden Jahr führt Birlinger aus, dass „der damalige Schultheiß Remigi Schaible und die beide Deputirte Karl Bondiz und Anton Hartmann samt dem gesammten Gericht und Gemeind […] also Sonne klar ein[sahen], daß ein merklicher Fehler ein geloffen sei und daß es der Bürgerschaft unerschwinglich wäre dieße angeszte Summa zu bestreiten, mann […] dahero aller Orthen [suchte …] und [sich] bemühte dießen Ansaz zu erleichtern. Allein! Es wollte sich nicht schicken und mann wollte unß aller Orthen abweßen.“Zitiert nach Frahm, Die Chronik des Schultheißen Birlinger (1770 – 1796), S. 104.)
Birlinger schreibt 1771 weiter: „Endlich machte man mit dem Deputirten Karl Bondiz einen Accord, und dießer übernahm den ganzen Proceß, mit dem Beding, daß wenn er etwas erhalte und von der angesezten Summe hinweg bringe, so werde Ihme 250fl. bezahlt werden. Er gienge dahero sogleich auf Ehingen an der Donau, und stelte die Sach einem Löblichen Directorio vor, worauf er auf das 1te mahl 22 fl. erhielte welches von einem bloßen Rechnungs Verstoß herkommen. Er saht nach und nach die Sache beßer ein und wurde gewahr, daß unß der eingegebenen Faßion zu wieder 133 Jaucherts Weinberg angesezet worden, welche sich aber nachmahls, als die Weinberg durch Peter Bäurle von Kiebingen, und mich als dem jetmahligen Schultheißen gemeßen wurden nicht höher als 78 Jaucherts befunden.“ (Zitiert nach Frahm, Die Chronik des Schultheißen Birlinger (1770 – 1796), S. 104. Bei o.g. Directorium in Ehingen handelte es sich um eine Ständevertretung Vorderösterreichs, welche u.a. für die Steuerbewilligunge zuständig war.) Die Gemeinde sah sich also aufgrund falscher Flächenannahmen seitens der Herrschaft zu Unrecht zu hoch besteuert.
„1772. Alß nun dieses einem Löblichen Directorio zu Ehingen abermahlich durch besagten Bondiz vorgestelet wurde, hat er abermals von denen vorbemelten 440 fl, 70 cr. wieder wieder abzuschlagen erhalten mithin in beeden mahlen hinweggebracht 55 fl. Über dießes hat man sich erkundiget und in die Erfahrenheit gebracht, daß unß jene Landgarben, welche theils dem Gotteshaus Kreuzlingen, Kirchberg, gnädiger Herrschafftlicher und andern Dominikal Herren, gelieferet und abgegeben werden müßen, unß bißhero noch nicht von Unßerer Rusticalsteur abgeschlagen worden, so hat man sich neuerdings benöthiget gefunden, dißes einem Hochlöblichen Directorio zu Ehingen vorzustellen, deßhalben ist bemelterBondiz und mit Ihme der Schultheiß Anton Birlinger den 23ten Februar 1772 wieder auf Ehingen abgerayset, und haben die Sache so weit betrieben, daß abermahlen in Rücksicht der noch nicht abgezogenen Dominikalsteur der Gemeind 14 fl. zusammen aber überhaubts in allen 3 Mahlen 63 fl. 20 cr. Abgezogen worden. Bey welchem es hernach sein Bewenden hatte, und obwohl man noch weitters die Sache betreiben wolte, nichts mehr erhalten. Gleich darauf suchte der damahlige Schultheiß Anton Birlinger und der Deputirte Karl Bondiz den Waidganglichen Streitt zwischen Jesingen und Wurmlingen zu beseitigen, ist aber aus Abgang der unß nöthigen Documenten nicht erörtert worden. Doch haben wir die Sache dahin gebracht daß wir alle Schriften mit welche sich Jenige bishero vertheitiget zu Henden gebracht haben.
1772, den 18ten Junij. Bevor ich aber meinen Bericht und Beschreibung weiters fortseze, so will ich zu erst anführen den Hergang und die Absezung des alten Schultbeiß Remigi Schaible, und die Aufstellung des neuen Schulthheißen Anton Birlingers. Daß außerordentliche grobe Betragen alten Schultheißen Remigi Schaible erweckte unter der gesammten Bürgerschafft nach und nach ein Mißvergnügen, wodurch so wohl Er als auch alle Gerichts Männer, alle Liebe, Gehorsam, und Ehrfurcht verlohren, worauf sich ihrer 8o Bürger zusammen grottet, und wieder die Vorgesezte in zerschiedenen Punkten bey einem Hochlöblichen Oberamt klagbar eingekommen worauf endlich resolviret wurde, daß eine eigene Comission auf Wurmlingen abgeordnet werden solte, welche derselben Klage und Beschwerden und entscheiden solte. Nach beschehener Untersuchung wurde dann endlich der alte Remigi Schaible abgesezet auch unter denen Gerichts Männern verschiedene Veränderungen gemachet, und statt seiner der jeztmalige Sehultheiß Anton Birlinger in seinem 25ten Alters Jahre aufgestelet. Zu Deputirten sind ihm zugesellet worden Karl Bondiz und Joseph Theurer, Richter Anton Hartmann, Peter Bisinger, Jerg Kleißle, Fidel Müller, Remigi Volmer und Anton Brunnmiller. Nach dießem wurde die Gemeinde wieder in Ruhe gesezet, und er alte Schultheiß und seine Anhänger immerhin noch zu Unruhen stifften suchten so wurde doch denselben wenig Achtung gegeben.“ (Zitiert nach Frahm, Die Chronik des Schultheißen Birlinger (1770 – 1796), S. 104f.)
In der Tübinger Kreisbeschreibung von 1972 findet sich eine Hintergrund-Information zum weiteren Chronik-Text: »Wegen des mühevollen Kirchganges besuchten die Dorfbewohner im 16. Jahrhundert immer häufiger, seit 1563 ständig den Gottesdienst in der St.-Briccius-Kapelle. Die Pfarrkirche auf dem Berg verwaiste und wurde 1563 auch von den Priestern verlassen.« (Zitiert nach Frahm, Die Chronik des Schultheißen Birlinger (1770 – 1796), S. 105.) Der Versuch der brav den Zehnten zahlenden Einwohner, die Dorfkapelle zur Pfarrkirche aufzuwerten und damit alle Unterhaltspflichten des Klosters Kreuzlingen und die entsprechenden Zehnt-Einnahmen vom Berg ins Dorf hinunter zu bringen, war ein Mitbestimmungsversuch der Gläubigen gegenüber den Kirchenoberen.
„Anno 1774. Im Frühe Jahr hat die Normal Schule ihren Anfang genommen, und muften auf den 13ten Junij alle Lehrer oder Schulmeister zu Erlernung der Normal Schulle eingeschicket werden. Ab seiten Wurmlingen schickte man den hiesigen Bürger und derzeit geweßten Meßner und Schulmeister Karle Schaible, welcher in der Sache sehr guten Fortgang machte, und unter denen mitlehren Schulmeistern einer der besten gehalten ward. Er bliebe aber nicht länger denn 3 Jahr darbey, sein hochmüthiges und protales Betragen, machte ihme mehrere Feind als Freund, welche nur auf eine Gelegenheit warteten womit man ihm von seinem Dienst abtreiben könte. Eß stunde auch wenige Zeit an, so mangelte es nicht Angelegenheit womit er könte vertrieben werden. Er machte in dem Herbst 77 einen beträchtlichen Weinbetrug gegen der Herrschafft und Kreuzlingen, welcher von der Herrschafft genauest untersuchet wurde, und da ihn die Gemeinde an Martini dieses Jahrs absezete so wurde auch diese Absezung nach beschebener Untersuchung von Obrigkeits wegen gebilliget, wie wohl es der Gemeind gegen 15 bis 20fl. Kosten verursachte.
Nach dießiem ist der hießige Bürger Johannes Merckh als Lehrer der Normal Schulle aufgestelt worden, welcher auch auf Kosten der Gemeind gelehret, aber dennoch zu dießem Geschäffte nicht der Tauglichste ware. Was aber den Lohn und die Betragung gegen der Gemeind betrifet ist man zeithero schon zufrieden. Gemäß der von Ihro K.P. ap. Mayestät herauß gegebenen Schulordnung, mußten wir wie alle anderen Orthschafften die Schulstube vergrößlern Bücher, Tabellen, und was zur Schule erforderlich auß gemeindtlichen Mitteln bestreitten, dem Schulhalter zu Heizung des Schulzimmers genügsammes Holz anschafen, Ihme nicht daß Schulgeld nach dem Kopf sondern alljährlich aus dem gemeindtlichen Seckel quartaliter bezahlen 5o fl. Kurz 600 fl. kleckt [klecken: ausreichen, genügen; vonstattengehen] nicht waß hier in Zeit 6 Jahr schon auf Kosten der Schuhe ausbezahlet worden, worunter das Jährliche Gehalt des Lehrers nicht gerechnet worden.
Am 16 ten Februar 1775 starbe der Deputirte Carl Bondiz, welcher der Gemeind Wurmlingen in zerschiedenen Umständen sehr vieles genüzet, und doch sich selbsten dabey niemahlen vergessen, nach deme er der Gemeind 20ig Jahr als Deputirter vorgestanden. Nach ihme wurde wieder zum Deputirten erwählet Anton Hartmann, welcher vor der Absezung des alten Schuhtheißen schon 17 Jahre als Deputirter geweßen.
Anno 1775. Im Frühe Jahr da der hießige Kirchenthurm oder daß Obere Glocken Hauß dem Einsturz sehr nahe war, gab die Gemeinde eine Bittschrifft bey seinem Hochlöblichen Oberamt zu Rottenburg ein und begehrte, daß die Zehenden Herrn das Ihre Gloken Haus möchten wieder aufbauen lassen, und daß die hießige Kirche, welche bishero noch niemahlen eine Pfarrkirche geweßen, zu einer Pfarrkirche solte benamßet werden, welches auch, aber erst in 5 Jahren zu stande gekommen. Zu folge dessen ist dann in anno 1776 das Kloken Haufe dahier abgebrochen und wie solcher würcklich daßtehet neu aufgebauen worden. Worzu die Hochlöblichen Zehend Theilnehmer 400 fl. bezahlen mußten. Da aber daß Gotteshauß Kreuzlingen als mit Zehend Herr die ihme zugetheilte 200 fl., bezahlet und daß Translocations Instrument abseiten einem Hochwürdigen Ordinariat außgefertiget worden, so wurde dem Reichs Gotteshauß Kreuzlingen, die Erlaubnis ertheilet die anvor geweße Pfarrkich auf dem St. Remigi Berg zu demoliren und nach Belieben ersucht löbliches Gotteshauß gänzlich abzubrechen. Welches aber in diesem Laufenden 1781 Jahre noch nicht geschehen, jedennoch hat gleich nach Ostern der sonst nach alter Gewohnheit am Freytag durch daß ganze Jahr gehaltene Gottesdienst aufgehöret, und denen hochlöblichen P.P. [P.P. Caputciner: Patres bzw. katholische Ordensgeistliche der Kapuziner], welche dießen Gottesdienst zu versehen gehabt, daß gewöhnliche Gehalt nicht mehr gereicht worden.
Es verlangte auch der gnädige Herr Reichs Prälat zu Kreuzlingen daß der Gottesacker von dem Berg transferirt und bey der jeztmaligen Pfarrkirch in dem Flecken solle angeleget werden. ob und wann aber dießes geschiehet wird die Zeit lehren.“ (Zitiert nach Frahm, Die Chronik des Schultheißen Birlinger (1770 – 1796), S. 106.)
Der Streit um die gerechten Abgaben und Abschläge bietet interessante Einblicke in den Alltag der Menschen. Aus der ungeschönten Perspektive der Zahlenden (und nicht aus der Aktenlage der kassierenden Herrschaft) ist ersichtlich, wem die Äcker, Wiesen, Wälder und Weinberge gehörten und wie hoch die Abgaben im Einzelnen waren. Zum besseren Verständnis des Chroniktextes von 1783 sei darauf hingewiesen, dass die gesamte Dorfflur aufgrund der Dreifelderwirtschaft die in drei Schläge (Zelgen) eingeteilt wurde, die abwechselnd mit Winter- und Sommergetreide bebaut wurde, ein Drittel war Brache. Diese Einteilung bildete die Grundlage für die zu entrichteten Abgaben an Geld, Frucht oder Korn.
„Anno 1783. Den 27ten Oktober ist der Deputirte Anton Hartmann seines deputirten Amts entlassen worden, nach dem er selbem 29 Jahr lang vogeestanden. Er hätte von rechts wegen sollen abgesezt werden, wegen eines von ihm angestelten Betrugs im Obern Wald. Man hat aber das Oberamt dahin berichtet, daß er auß Ursache, weillen Philip Walter und ersagter Hartmann gegen Schwiegervätter gegeneinander geworden sind, er allso in Ehren entlassen worden. Zu gleicher Zeit ist auch Hanß Jerg Kleißle der damahlen der erste Richter ware, und die nächste Hofnung zur Deputirten Stelle gehabt hätte, wegen zerschiedenen Unanständigkeiten abgesezt worden. Und statt seiner und des Deputirten Anton Hartmann ist Fidel Theurer und Lorenß Beckh zu Richtern angestelt worden. Wonach alsdann der Fidel Müller zu dem schon angestelten Deputirten Peter Bisinger ebenfalls als Deputirter angenommen worden. Gleich darauf im Juni 1784 ist Philip Walter gestorben, und für selben ist an Martini 1784 Lukas Merckh zum Richter angenommen worden.
Im November 1784 ist der gnädige Herr Robotabilizions Hoff Comissarij Herr Franz Anton von Blanck und unser damaliger Landvogt, in alle Niederhohenbergische Herrschafts Orth gekommen, denen selben die Frohnabläsung angetragen, so zwar daß statt des vorhero gewesten ungemeßenen herrschaftlichen Frohns, iezo mit Einschluß des vorhero von jedem Zugstüke und Handfröhner zu bezahlen schuldigen 10fl. 6 cr. in Zukunft von jedem Zugstüke 1 fl., von dem Söller oder Handfröhner 32 cr., von einer Mitfrau aber 16 cr. bezahlet werden solle. [Mitfrau: eine Witwe, die Anspruch an der Allmendenutzung hatte.] Welche Summe zu Früchten geschlagen, und nach dem zwischen Michaeli und Martini besthenden Mitleren Markht gewiß berechnet, nach welcher Berechnung als der Unterthane, nach seiner Willkühr Frucht oder Geld auf Martini bezahlen solle und müße. [Der mittlere Markt fand also zwischen dem 29. September und dem 11. November bzw. zwischen Erntedank und Kirchweih und dem Zins- und Ablösetag eines jeden Jahres statt.]
Nach langer Berratschlagung in einer so wichtig als schlipfertigen Sache, haben sich allso von jenen mit dem ohngemeßenen Frohn beladenen 10 Orthschaften derselben einhellig einverstanden, und den angebottenen Contract mit deme eingegangen, daß denselben daß hierüber aungefertigte Contracts Instrument jeder Gemeinde in Copia zugestellet werden solle. Kraft welchem, zu ewigen Zeiten, sich für Zufälle ereignen was nur immer für es sein mögen, sich niemahls mehr zu einer Frohn wie die auch nur immer Nahmen haben möge könne oder dürfe angehalten werden. Auch weillen die Herrschaft in Zukunft alle bishero in Frohn verrichtethen Arbeiten um den Lohn verrichten lassen muß, sie jeder den Frohn abgelöset, diese Arbeithen, gegen Bezahlung zukommen lassen, und wenn es andern auch wieder Billigkeit und Versprechen, solte zugeschanzet werden, sie jederzeit daß Recht haben sollen, die anderen zugeschanzete Arbeit, gegen den entwieder accordirten oder stipulierten Lohn an sich zu ziehen und auflulösen.
Die diesen Contract angenommene Gemeinden sind Hirschau, Wurmlingen, Kiebingen, Seebronn, Hailfingen und Ergenzingen, jene aber welche diesen Contract nicht angenommen sind Weiller, Dettingen, Schwalldorf und Niedernau. Welche das beste gewählet haben wird die Zeit lehren. NB: Eß ist dieser Contract nicht begenehmiget worden, weil nicht die ganze Landschaft zusammengehalten hat.“ (Zitiert nach Frahm, Die Chronik des Schultheißen Birlinger (1770 – 1796), S. 109.)
An einer schwer lesbaren Stelle in Birlingers Aufzeichnungen sind ursprünglich insgesamt 90 Malter Korn als Abgabe an die Megenzer notiert. Ein Malter entsprach in der Grafschaft Hohenberg nach altem Getreidemaß 181 Liter glatte Frucht (Körner) oder 193 Liter rauhe Frucht (Veesen): 1 Malter = 12 Viertel 48 Imi. Das Geschlecht der Megenzer von Felldorf hatte beträchtliche Besitzungen in Wurmlingen, welche an acht Familien verpachtet wurden. Hierbei handelte es sich um die Familien von Martin Gaus, Jakob Hartmann, Hans Jerg Kleißle, Thomas Ehing, Johannes Wachendorfer, Lorenz Bondiz sowie Hans und Karle Schäuble. Die Menge der Abgaben wurde aber auf 88 Malter, 7 Viertel und 2 Imi korrigiert:
„Anno 1785. Gleich bey Eintritt dieses Jahres ist durch vorermelten Hochwohlgebohrenen Herrn Hoff Comissarij von Blanckh, dieß hiesige Herrschaftlichee Megenzer Guth als ein Erblehen denen 8 Lehensmännern Martin Gausß, Jakob Hartmann, Hanß Jerg Kleißle, Thomas Ehing, Johannes Wachendorfer, Lorenz Bondiz, Hanß und Karle Schäuble mit deme übergeben worden, daß dieselben jährlich so wohl für den Wiesen Zinß als die Landgarb, auß den in 3 Zelgen liegenden 64 Morgen Ackers und ohngefähr 12 Morgen Wiesen und Gärthen 1 Morgen Länder an Korn bezahlen sollen 88 Malters 7 Vierthel 2 Imi Korn. Nachhers aber denen Lehenännern freystehet, ob dieselbe die ganze Summa mit Hälfte mit Geld bezahlen wollen. Auch ist ihnen bedungen worden daß wenn nach 20ig Jahren, der Durchschnitt von dem Frucht Preiß um den 6ten Theil sich erhöhen solte, so müßten die Lehenmänner mit ihrer Lehen Summa um den 12ten Theil aufsteigen. Solte aber der ermelte Fruchtpreis, um den 6ten Theil nach dem 20ig jährigen Durchschnitt herabfallen, so sollen die bemelte Lehenmänner ebenfalls über den 6ten Theil ihres angesezten Lehen Korns weniger zu geben schuldig sein. […]
Den 28ten Aprill 1785 ist in Präsenz des vorermelten Herrn Hof Comissarij von Blanckh zwischen der löblichen Stadt Rottenburg, und dann denen 6 Gemeinden Hirschau, Wurmlingen, Wendelsheim, Bihl, Kiebingen, und Niedernau, der Ausländersteuer wegen ein Vertrag gemachet und entworfen worden, daß sowohl die Stadt Rottenburg, als die obbemelte Gemeinden welche Gütter im Rottenburger Lehn haben, und jene Rottenburger, welche Güter im denen ermelten Gemeinds Bännen besizen, jährlich von ihren in auswärtigen Bännen liegenden Gütern das Dopelte bezahlen sollen, was ein anliegender Innländer aus seinem Guth bezahlet, als zum Exempel ein Rottenburger hat auf der Fildern 1 Morgen Ackers welcher im Stättischen Anschlag zu 35fl. angesezet ist und allso zu 4 Steuren a 9 cr. betraget summa 36 cr., so hat ein […] Wurmlinger welcher gleichfalls 1 Morgen daselbst hat 1 fl. 12 cr. zu entrichten und so viceversa haben auch die Rottenburger nach Wurmlingen […] zu beahlen. [Die Ausländersteuer betraf alle Nicht-Wurmlinger, die Grundbesitz auf der Gemarkung hatten.] Damit aber kein Ort das andere in dem Anschlag übervortheilen könne, ist beschlossen worden, daß ein Ort dem anderen seine Anschlags Extracte einbändigen solle. Damit jeder Innhaber eines ausländischen Guths sich selbsten die Rechnung machen könne, was er nach der Anlaag jeden Orts zugeben schuldig seye.
Nebst deme ist aber doch beschlossen worden, daß keine Gemeinde der Contrahierenden Theilen, der anderen in Anlengung der Steuern ein Griff oder Ordnung zugeben habe und was jeder Bürger oder einheimische bezahlt die Auswärtige Dopelt zu entrichten schuldig sein sollen. Bey diesem ist weiters verabredet worden, daß wenn in Kriegs Zeiten, wo die Steuern sich so hoch belaufen, so solle der auswärtige nur was bey Friedens Zeiten angelegt doppelt zu bezahlen schuldig sein, jenes aber was währendem und wegen dem Krieg angelegt ist jeder auswärtige nur nach dem gleichen Maß des einheimischen bey zu tragen schuldig. Von welcher Verhandlung jeder Contrahierenden Gemeinde eine Abschrift mitgetheilet worden.
Ohnerachtet daß schon vorhero gemeldet worden war daß man von Seiten Wurmlingen schon über 600fl. auf daß Schulhaus und andere erforderniße der Normalschule verwendet, so wurde dennoch das Schulhaus von denen Herren Schulvisitatoren hinweg gesprochen, und anderst zu bauen anbefohlen, uuf folge dessen wurde dan im Jahr 1786 daß Schulhaus gänzlich verändert und anstatt daß ehevor die Schulstube im untern Stock ware, so wurde dieselbe oben aufgerichtet des Mesners Wohnung aber unten hinein gemachet, es wurde auch zu gleich ein neuer Gibel gegen dem Wetter gemachet und daß ganze Hauß von ausen bestochen und recht ordentlich hergestelt worauf man abermahls einen Posten von 600 fl. verwendete.
Im Jahre 1787 haben die von Wurmlingen die schon im Jahre 1785 übernommene Straßen Strecke zwischen Kiebingen und dem Bildstockle oberhalb Bihl vollkommen chaußirt und aus gemachet, wobey man jedem Bauern mit 2 Zugstücken täglich 1 fl., dem Handfrohner aber 20 cr. Taglohn bezahlet, und einen Posten von 700fl. hierauf verwendet. In dem nämblichen 1787ten Jahre hat man das Stück Weg von des Christian Bauern Haus biß zu dem Kirchweg ganz mit neuen Blatten besezen und belegen lassen, deßgleich ist auch der Brunnen mit Blatten ganz besezet worden, auch hat man den Graben unter dem Brunnentrog ausgemauret und auch unterhalb mit Blatten besezt von diesem ist denen Maurerren bezahlt worde Gemäß Accord: 22fl. und Aufbesserung: 4 fl. 30 cr. Zusammen: 26 fl. 30 cr.
Anno 1788 hat man den Kirchenweeg vor des Fidel Lenisen Hauß und auch das Stückle zwischen des Fidel Lenisen Hau,ß und Johannes Millerers Schmidte mit neue Wendelsheimer Blatten belegen lassen ersteres haben Karle Bauer und Peter Kleisle für 3 fl. 30 cr. Letzteres aber Ignaz Heß zu 5 fl. gemachet.
Im Jahr 1787 ist ein von allerhöchstem Ort herausgegebenes Normativ [= Vorschrift] bekannt gemachet worden, kraft welchem die Hütweiden welche zu einer nüzjichen Cultur gebracht worden auf 30ig Jahr von der Abgaabe bejreyet sein sollen.
Zu folge dessen meldete sich die Gemeinde Wurmlingen durch ein dem Obermat eingegebenes Memorial [= Vormerkbuch] wegen denen Umgebrochenen Allmend Plätzen, oder sogenannten Flecken Ländern, welche im Jahre 1766 und 1768 umgebrochen worden und anvor eine Schaafweid gewesen und woraus schon seit anno 1778 der Zehenvorden gereicht worden, solchen aber nicht schuldig gewesen wäre: daß Flecken Länder noch fernere 20ig Jahre von der Zehend Abgabe befreyet werden möchten. Der damahlie Herr Pfleegeer Leontius Lang als welcher diesen Zehend alleinig bezogen, protestirte zwar sehr stark dagegen, jedennoch wurde der Gemeinde vergönnet und zugesprochen, daß von diesen bemelten Flecken Ländern 1787 bis 1807 nämblich noch 20ig Jahr weil selbe anfänglich nur 10 Jahre frey geblieben, von der Zehend Abgaab befreyet sein sollen.
Diese Flecken Länder welche von der Zehendabgab befreyet sind liegen 1tens das untere Gewand unter des Kiefer Franzen Rein ob dem Fleckem Acker, item jene neben denen Dauben Äckern die unter denen Weckholder Äckern worzu auch noch 2 Vierthel obdem Weckholder Flecken Acker gehörig, item all jene welche im untern Gewand denen Gengenthällern zu liegen sowohl rechter als linker Hand des Gengenthäller Weegs. Ferners jene im Brungstall welche gegen dem Bauren Wald stoßen desgleichen jene so diesseits und jenseits der Schafklinge liegen auch weitters jene im untern Gewand unter dem langen Flecken Acker welchen iezt Hanß Jerg Ehing und Johannes Miller Schmid besizen, zu denen gehören noch einige von unten herauf welche gegen der Gaß zu hinauf streckhen und sonst noch einige einzelne Stücke. Die weitern aber welche schon vor ohngefähr 45 Jahren angebauen worden müssen den Zehenden hierfüro wie bishero abreichen.“
In Rottenburg hatte sich 1792 ein Trupp Revolutionsflüchtlinge eingenistet. In Wurmlingen dagegen waren nach dem Ausbruch der sogenannten Franzosenkrige Condé‘sche Truppen und französische Exilanten einquartiert, die gegen das revolutionäre Frankreich aufmarschieren wollten. Im Rößle, damals wohl das beste Gasthaus in Wurmlingen, war die Condé’sche Nobelgard einquartiert. Die Kosten hierfür hatte die Gemeinde zu ersetzen („Ausgaben auf Fleckenzehrung“). Das erste Emigrantencorps (1.100 Mann und 500 Pferde) unter dem Kommando des Grafen Viomenil hatte Ende 1792 das Winterquartier in Rottenburg und Umgebung bezogen und die fremde Welt des französischen Adelsstolzes importiert: Gleich am ersten Tag Ankunft duellierten sich zwei Emigrés in Wendelsheim auf Pistolen und zwei andere in Rottenburg auf Degen. Auch die nächsten zwei Winter waren die Exilanten einquartiert. Der Rottenburger Chronist Haßler spricht von dem „frivolen Wesen“ der Emigranten: der junge französische Adel habe hier seine Tage in „Festgelagen und ausgelassenen Zerstreuungen, Komödien, Hazardspiel [Glücksspiel] und Liebeshändeln zu [gebracht].“
„Anno 1794. hat der damalige Herr Pfarrer und Pfleeger Augustin Honsel mitelst oberamtlichen Rechtsspruch, verlanget und begehrt, daf alle neu erbaute Häuser welche dermalen 13 an der Zahl waren einem jeweiligen Herrn Pfarrer den Blutzehenden abreichen sollen; Da aber von uralten Zeiten her, gewiese Zehendefreye Häuser gewesen, und wer nachhin auf Zehend freye Pläze gebauen, bißhero von der Blut Zehend Abgab befreyet blieben sind.
Obwohlen man von seiten der Gemeinde, dem Oberamt alle Gründe darlegte, daß, und warum die auf Zehend freye Pläze gehauene Häuser solten Zehend frey bleiben, nichts desto weniger wurde unß zugesprochen, daß die neu erbaute Häuser, sie mögen auf Zehend freyen, auf Allmend Pläzen, oder auf zehendbare Gründe gebauen sein den Zehenden abreichen sollen. Der Herr Pfleeger behauptete daß, mit der Zahl der neuen Häuser, auch sich seine pfarrliche Verrichtungen vermehren, und daß jene welche Blutzehend frey seyen, von alters entweders den Stiftern oder Beschüzern der Pfarrey zugehöret hätten; welches aber nicht wahrscheinlich.
Die Bürgerschaft dahier wurde durch diesen Actus zimmlich stark aufgebracht, und allgemeines Mißtrauen und Abneigung gegen dem Herrn Pfarrer durchlieff die ganze Bürgerschaft, weil man die Unterthanen oder Pfarrkinder so liebloß, interesierlich und ohngerecht behandlen wolte.
Ich als Vorsteher wußte mir bey dieser Lage nichts bessers zu dencken, als dieselbe dem gnädigen Herrn Reichs Praelaten [= höherer Geistlicher und gleichzeitig Reichsstand] zu Kreuzlingen schriftlich vorzulegen, und zu bitten daß er die auf Zehend freye Pläze erbauten neuen Häuser von der Blutehend Abgab befreit belassen möchte, welche Er auch, weil er die Billigkeit einsahe, sogleich laut eines erhaltenen Schreibens vom 18ten Juny 1794 frey zählete mit diesen Worten »dem Herrn Pfleeger schreibe ich unter dem heutigen Dato wegen der Freylassung der freyen Pläze, und Häuser welche darauf gebauet sind vom Blutzehenden«. Die übrigen aber welche entweders auf Alimend Pläze, oder auf Zehendbare Gründe gehauen worden, mußten sich der Zehend Abgabe unterwerfen. Der damalige Herr Pfleeger und Pfarrer Augustin Honsel aber wurde bald hierauf von dem gnädigen Herrn Reichs Praelaten von hier abgerufen und zu Kreuzlingen als Kastner aufgeßtelt. Welchen Herr Petrus Umhofer ganz unvermuthet, mitten in der Ernd dahier ablösete und nach Hauß schickte. Vom 22ten Julij 1794 an ware dann besagter Herr Peter hier, welchergleich im 94ger Herbst eine abermahlige Streitigkeit mit der Bürgerschaft anfienge. Es wurde nämblich von gnädigster Herrschaft wegen all jenen Weinbergs Besizern, welche neue Weinberge anlegten, sowohl zu Rottenburg als allen umliegenden Weinorten, vergönnet, daß sie 10 Jahre lang von aller Zehend und Landgarbs Abgabe befreyet sein dürften. Welches unser Hochlöblicher Pfleeger aber nicht anerkennen wolte, weil ihm dieses in seinen Weingefallen nicht wenig nachtheilig ware. Es wurde daher diese Sache von dem Oberamte abgeurtheilt, und der schriftliche Bescheid ertheilet, daß unter dieser Zehend Befreyung nur jene Weinberge verstanden, welche noch niemahlen als Weinberge angelegt gewesen, und auf welche noch niemahlen wurde Gewalt noch Kräfte verwendet worden, worunter aber keineswegs jene verstanden seyen, welche schon einmahl als Weinberge angelegt gewesen, und ausgestocket, einige Jahre mit Klee, Erdäpfel, oder Früchten angeblümt gewesen. Nicht nur die Weinbergs Innhaber von Wurmlingen, sondern auch jene zu Hirschau, wurden demnach zu Entrichtung ihrer Zehend und Landgarbs Abgabe, von der bei alten, aber neu angelegten Weinbergen angewiesen. Weil man aber von seiten der Herrschaft in derley Fällen Dißimulirte [= etwas verbergen], so wurde auch dem Kreuzlinger Pfleeger nichts verabfolget.“ (Zitiert nach Frahm, Die Chronik des Schultheißen Birlinger (1770 – 1796), S. 110-112.)
Besonders bei der zweiten Einquartierung französischer Soldaten im Winter 1794 sammelte sich „die Blume des alten französischen Adels. In den Abendgesellschaften funkelten und blitzten die Diamanten an den Fingern der Herren […] und am Kopfputz der Damen.“ Es handelte sich also um anspruchsvolle Gäste, die die niederhohenbergischen Bauern und Wirte bzw. ihre Vorratskammern außerordentlich belasteten. In den folgenden Jahren mussten wiederholt französische Militärkontingente aufgenommen und vor allem mit Getreide und Fleisch verpflegt werden, wobei zusätzlich „Nothsteuern“ und „Boten- und Spanndienste“ für deren Logistik zu erbringen waren (Ludwig Anton Hassler, Chronik der Königlich Württembergischen Stadt Rottenburg und Ehingen am Neckar. Rottenburg 1819, S. 253f.), was nach den schlechten Wein- und Erntejahren zwischen 1789 und 1793 eine weitere Verknappung und Verteuerung der Grundnahrungsmittel bedeutete, zumal im strengen Winter 1788/89 viele Obstbäume erfroren waren.
Die Region um Rottenburg war erneut Kriegsschauplatz: »Im Juli 1796 überschritt der französische General Moreau den Rhein, bemächtigte sich des nur von schwachen wirtembergischen Kräften verteidigten Kniebispasses und schlug die Österreicher am Dobel bei Herrenalb und bei Cannstatt zurück. Wirtemberg und der Schwäbische Kreis schlossen nun mit Frankreich einen Waffenstillstand, der dem Land von Österrreich sehr verübelt wurde; bei Biberach wurden die schwäbischen Kreistruppen von den Österreichern entwaffnet.« (Karl Weller, Württembergische Geschichte im südwestdeutschen Raum. 9Stuttgart 1981.) Auch das vorderösterreichische Wurmlingen war betroffen und die Einwohner vom Kriegsalltag betroffen, wie Birlinger nun in seiner Chronik in Bezug auf die sogenannten Franzoseneinfälle verdeutlicht:
„Anno 1796. Obwohlen schon im Jahre 1790 zwischen unserem allergnädigsten Monarchen dem Römischen Kaiser und Erzherzog von Österreich dann der Krone Frankreich ein blutigerKrieg ausgebrochen, so aber sich von anno 1790 bis 1796 immer hin in denen Niederlanden und an dem Unterreihn erstrecket, und das Kriegs Theatter aufgeschlagen hatte, wo der dapfere Kriegsheld Prinz von Coburg, die mehreste Veste Stätte in den französischen Niederelanden erobert und eingenommen hatte: auf einmal aber wurden die österreichischen Armeen sammt ihren Hilfs Völckern aus Niederlanden vertrieben, und über dies auch über den Rhein zurückgejaget worden. Dies geschahe dann im Jahr 1796 daß die Franzosen bey Kehl über den Rhein gesezet, und die Reichs Truppen welche bei Kehl gestanden übermeistert und zurückgetrieben und folglich daß ganze Reich überrumplet. Den 17ten Julij obigen Jahres sind die ersten französischen Chaßeer auf Rottenburg gekommen und gleich auf den Abend zwischen 10 und 11 Uhr kommen auch 3 Chaßeer welche unter allerley Vorwendungen 12 Pferd verlangten, endlich aber mit einer Gelderpressung von 88 fl. wieder abzogen. Des andern Tags kommen wieder 10 solcher Geldpresser, welche 6 Ochsen verlangten, und dafür eine Summe von 110 fl. annahmen.
Den 19ten kommen wieder dergleichen Ouartiermacher, welche die Sache so lange herumgetrieben, bis sie endlich auf 44 fl. verfallen, welche man ihnen bezahlen solte. Welche man aber nicht gegeben und mit Wein und Brodt abgespeißt.
Den 21ten sind wieder dergleichen Quartiermacher gekommen, welche Generalquartier zu machen, und da diselbe außerordentlich grob sich aufgeführt, so sind dieselbe von der zugelofenen Mannschaft tüchtig abgeprüglet worden. Welches unß aber nach der hand sehr vieles geschadet. Der hiesige Bürger Vranz A. welcher, weil er französisch reden könte beygezogen wurde, ist von ihnen als der Anführer 3 Tag arretirt worden, und jeder glaubte er werde gar erschossen. Den 22ten Julij als am Maria Magdalena Tag rückten morgens ohngefähr um 3 Uhr 900 Mann dahier in das Lager, welche sie mitten im Kornfeld welches der Reiffe nahe war, angesteckt hatten ein, und um 9 Uhr morgens kommen wieder ebenso viel nach, welche ihr Lager vom Gaißwasen den Lacherweeg hinaus hatten. Da mußten ihnen Holz, Stroh und Wein in daß Lager abgegeben werden; im Lager blieben sie 2 Tage, und dann kamen 1 Batalion auf Hirschau ins Quartier, und 1 Batalion hieher, so daß es auf den Steuergulden 10 Mann betrofen und blieben 2 Tag. In dieser Zeit ihres Hierseins brauchten wir in allem an Wein ohngefär 12 Ohm [ca. 1.800 l], Brodt kann nicht angegeben werden und an Fleisch 4 Ochsen 1 Rind und 1 Kalb.“ Das Ohm ist eine beinahe ausschließlich auf Flüssigkeitsvolumina angewendete Volumeneinheit, die sich von lat. ama (Einer), ableitet. Angewendet wurde der Begriff auch (aber nicht ausschließlich) auf Wein. Grund der Entstehung waren die Gegebenheiten, die der Transport größerer Mengen von Flüssigkeiten mit sich brachte. Ein Ohm entsprach der Belastbarkeit eines Tragtieres. Da man an unterschiedlichen Orten unterschiedliche Lasttiere benutzte (Esel, Maultier, Pferd), erklären sich daraus auch die divergierenden Entsprechungen zu den Maßen in verschiedenen Regionen. 1 Tübinger Ohm = 146 l. (Helmut Kahnt/Bernd Knorr, Alte Masse, Münzen und Gewichte. Bibliographisches Institut Mannheim/Wien/ Zürich 1987; Wolfgang Trapp, Kleines Handbuch der Maße, Zahlen Gewichte und der Zeitrechnung. Stuttgart 21996.)
„Dem 25ten Julij als an Jakobi mitags um 1 Uhr mußten diese Gäste abmarschieren von hier nacher Nürtingen, und bevor sie abmarschirten kauften sie dahier von Verschiedenen Bürgern 13 Pferdt für Mandaten [ein Kauf für Mandanten erfolgte gegen eine Zahlungsvollmacht, die man aber damals ebenso wie die fremde Papierwährung gegen eigenes Geld einlösen konnte] oder Papiergeld, wofür auch keiner kein Kreuzer bekommen, nebst dene hat auch Fidel Walter Schneider Karre samt Pferdten zurückgelassen, wie er ihr Bagage fortgeführt welche alle nochmahls von der Gemeind bezahlt worden. Auch mußten ihnen 100 Paar Schuhe und 100 Hemter geliefert werden. der sämtliche Schaden welche dieselbe der Gemeinde verursachten hat sich nach beschehener Abrechnung auf 3000 f1. belaufen.“
In der ältesten erhaltenen Gemeinderechnung Wurmlingens aus dem Jahr 1796 zeigt sich deutlich, dass die kriegerischen Ereignisse in diesen Jahren nicht aufhören wollten („den 18. Juli sind die Patroulien von denen Franzosen hierein gerückt, und haben 15 Pferdt und 40 Ochsen abverlangt“, Württembergische Truppen dagegen hatten auf dem Kappellenberg Stellung bezogen), fiel der Hauptteil der Gemeindeausgaben damals auf „Militärerlittenheiten“ (Zitiert nach Müller, S. 98.), im Jahr 1796 nicht weniger als 87 Prozent. Die Württemberger Soldaten verhafteten gar den Schultheiß Anton Birlinger. (900 Jahre Wurmlingen, S. 429.)
„1799 sind die Franzosen wieder herüber gefallen, haben aber ihren Marsch über Tutlingen und Osterach genommen, wo sie sogleich geschlagen und ihr Rückweeg nach der Schweiz genommen.“ (Zitiert nach Frahm, Die Chronik des Schultheißen Birlinger (1770 – 1796), S. 112f.)
Die Zeiten, die auf die sogenannten Militärerlittenheiten Ende des 18. Jahrhunderts folgten, waren keineswegs besser: die Napoleonischen Kriege und die Hungersnot von 1816/17 brachten nicht nur die Armen, sondern auch den Mittelstand auf dem Land oft um den letzten Kreuzer. Wie oben erwähnt war Schwaben nach dem Ausbruch der sogenannten Franzosenkriege ein Kriegsschauplatz und auf den hohenbergischen Gemeinden lasteten große finanzielle Belastungen, wie man u.a. Anton Birlingers Aufzeichnungen aus dem Jahr 1796 entnehmen kann. Die Wurmlinger litten zunächst unter den Durchmärschen der französischen Truppen und den Einquartierungen der österreichischen, zwischen 1796 und 1805 kamen wiederolte Franzoseneinfälle hinzu. Am verlustreichsten war dabei der erste feindliche Einfall: die erhaltene Gemeinderechnung von 1796, die die Ausgaben für „Durchmarsch, Winterquartier, Vorspan und Naturallieferung“ mit nicht weniger als 11.689 fl. beziffert, belegt die hohen Kosten, denn die Franzosen nahmen zahlreiche Pferde, Ochsen und Schafe mit, außerdem größere Mengen Wein, Hafer, Heu, Klee und sogar Most. (Wurmlingen … es war einmal, S. 58.)
Napoleons Sieg über die Österreicher und ihre Verbündeten im Jahr 1805 führte am 26. Dezember 1805 zum Preßburger Frieden, durch den die Habsburger nach der verheerenden Niederlage gegen Frankreich im Zuge der Mediatisierung auch die vorderösterreichische Grafschaft Hohenberg an Württemberg abtreten mussten. So wurden neben der Amtsstadt Rottenburg auch ehemals niederhohenbergischen Dörfer – darunter Wurmlingen – Teil des am 1. Januar 1806 entstandenen Königreichs Württemberg. Die offizielle Übergabe erfolgte am 28. Mai 1806 und sechs Wochen später kam der neue Landesherr König Friedrich I. nach Rottenburg, um seine neuen Besitztümer und Untertanen in Augenschein zu nehmen.
Durch die württembergische Inbesitznahme entstanden erneut hohe Kosten, von denen die Wurmlinger anteilig 88 fl. 3 kr. übernehmen mussten. (Karlheinz Geppert, Ackerbau und Viehzucht, Wein- und Hopfenanbau – Wurmlingen im 19. Jahrhundert. In: Ders. (Hg.): 900 Jahre Wurmlingen, S. 114.)
Dieser Übergang aus österreichischem in württembergischen Besitz brachte wenig einschneidende Veränderungen des Alltags mit sich und führte wohl auch nicht zu einem emotionalen Zwiespalt in der Gemeinde. „Zum Abtrauern feudaler Anhänglichkeitsgefühle oder zu nationalen Identitätsproblemen bestand wenig Anlaß. Der Loyalitätsanspruch der neuen Macht war genauso absolut, genauso abstrakt und selbstverständlich, wie es jener des alten Regimes gewesen war. Und das Sich-Fügen in fremdbestimmte Schicksalsentscheidungen, in den eigenen Verkauf und den Herrentausch […] gehörte zumindest als überliefertes Erfahrungsmoment zum feudalgesellschaftlichen Erbgut der österreichischen so gut wie der württembergischen Untertanen.“ (Wolfgang Kaschuba, Bauern und andere – zur Systematik dörflicher Gesellschaftserfahrung zwischen Vorindustrialisierung und Weltwirtschaftskrise. In: Ders./Lipp, Carola, Dörfliches Überleben. Zur Geschichte materieller und sozialer Reproduktion ländlicher Gesellschaft im 19. und 20. Jahrhundert. In: Hermann Bausinger, Utz Jeggle, u.a. (Hg.), Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts der Universität Tübingen, Bd. 56, Tübingen 1982, S. 13.) Im Verhältnis zwischen Bauern und Obrigkeit änderte sich nichts, es gab nach wie vor keine feudalen Zwischeninstanzen, und auch die Praxis der Realteilung im Erbfall galt weiterhin.
Kaum württembergisch geworden, kamen allerdings neue (militärische) Verpflichtungen auf die Wurmlinger zu, denn der württembergische König – und damit seine Untertanen – waren wie bereits erwähnt zum Militärdienst für Frankreich verpflichtet. Es dauerte nicht lange, bis Napoleon dies einforderte und auch etliche Wurmlinger für ihn in den Krieg ziehen mussten. Im Russlandfeldzug 1812/13 fielen 30 Wurmlinger Männer. (900 Jahre Wurmlingen, S. 429.)
Einnahmen der Gemeinde
Die wichtigsten Einnahmequellen Wurmlingens waren der Holzverkauf aus dem Gemeindewald und die Ausbeutung der Gipsgrube (s. „Wurmlinger Zucker“). Außerdem erhob die Gemeinde von ihren Bürgern das sogenannte Rauch- oder Kamingeld, das jährlich 10 kr. betrug, 1796 jedoch auf 16 kr. erhöht wurde, wobei Witwen nur die Hälfte bezahlen mussten.
Das Rauchgeld (auch: Rauchschatz, Feuerstättenschatz, Hausstättenschatz oder Kamingeld) war eine Abgabe, die nach der Zahl der Rauchfänge entrichtet wurde. Der Haushaltsvorstand ist namentlich genannt, nur ausnahmsweise auch Beruf. Solche Register enthalten den Steuerbetrag je Haushalt und geben einen Einblick in die soziale Schichtung der Bevölkerung. (Reich, S. 30.) Das Rauchgeld wurde in Wurmlingen ebenso umgelegt wie der Schäferlohn und das Salzgeld. Weitere Einkünfte brachten die Rügungen und Strafen, die sich meist auf Feldfrevel bezogen. Die Fleckendiener (auch: Fleckenschütz, Waldschütz, 2 Haldenschützen, Schäfer und Kuhhirt) wurden jährlich neu gedingt und hatten bei ihrer Aufnahme je 45 kr., zu bezahlen. Vor 1849 war beispielsweise der Weingärtner Bruno Bierlinger Fleckenschütz (StAR-C170-2, Karton 42, Tagebuch-Nr. 0025-119 (Eventualteilung T 03-0131 Wurmlingen 1849)), 1854 übte das Amt des Fleckenschützes Thomas Ehing aus. (StAR-C170-2, Karton 44, Tagebuch-Nr. 0037 (Realteilung T 04-0057 Wurmlingen 1854))
In Bezug auf die wirtschaftlichen Verhältnisse in Wurmlingen kam die Pfarrvisitation des Jahres 1819 zu folgendem Urteil: „Der Wohlstand der Gemeinde ist mittelmäßig und es gibt auch immer mehr Arme.“ (DARott G 1.8, Nr. 472 (Pfarr-Visitation 1819))
Eine Agrarkrise folgte in den 1820er Jahren, als eine Reihe von guten Ernten den Zusammenbruch der landwirtschaftlichen Preise verursachte und so den Bauernstand hinunterzog. Die Zeiten waren nicht mehr danach, dass die Wurmlinger ins Wirtshaus gehen konnten. Es ist daher nicht verwunderlich, dass von den ehemals vier Wirtschaften im Ort mit dem Rößle und dem Löwen nur zwei übrig blieben.
Der Ort umfasste 1821 141 Wohn- und 105 Wirtschaftsgebäude, laut der Oberamtsbeschreibung von 1828 gab es insgesamt 235 Häuser (167 Haupt- und 64 Nebengebäude), 1 Rathaus, 1 Schulhaus, 2 Wirtschaften, 1 Kirche und 1 Kapelle. „Die Einwohner ernährten sich [zu Beginn des 19. Jahrhunderts] weniger durch Gewerbe als durch sehr beträchtlichen Acker- und Weinbau, auch gewährt das Gypsgraben hier einen bedeutenden Nahrungszweig; sie sind nicht mittellos, sparsam, doch schleicht sich gar in neuer Zeit ein Geist der Zwietracht in die Gemeinde.“ (DARott G 1.8, Nr. 470 (Pfarr-Visitation 1810))
Neun Jahre zuvor, 1801, hatte die Pfarrvisitation ergeben: „Der sittliche und religiöse Zustand der Gemeinde ist im allgemeinen ziemlich gut; [es] neigt zwar besonders die erwachsene Jugend zum lustigseyn“ (DARott G 1.8, Nr. 472 (Pfarr-Visitation 1819)), und auch 1806 waren „keine besonders auffallende[n] Fehler, außer dem Auslaufen der ledigen Leute in auswärtige Orte zu Tänzen […]“, zu beobachten. Der Begriff „Auslaufen“ stammt aus örtlichen Pfarrberichten des frühen 19. Jahrhunderts und beschreibt ein soziales Phänomen: Die Ortspfarrer – wohl als Sprachrohr der herrschenden öffentlichen Meinung – bezeichneten so die in ihren Augen bedenkliche Angewohnheit der Jugendlichen und Ledigen, abends und an Sonntagen den mehr oder weniger heimlichen Weg in die Nachbarorte oder die Amtsstadt einzuschlagen, um dort Unterhaltung und Abwechslung vom Dorfleben zu suchen, wobei es um eine Auszeit vom dörflichen Kontrollsystem, ein wenigstens kurzzeitiges Heraustreten aus dem Normengefüge ging, in dem alles Private zugleich öffentlich war und Freiräume oder gar Freizeit nicht existierten, da der wachsende Berg von Pflichten und subsidiären Aufgaben, der den Wechselrhythmus von Anspannungs- und Entspannungsphasen des bäuerlichen Arbeitsprozesses einseitig beschleunigte, kaum noch physische und psychische Regenerationspausen enthielt. Das Bedürfnis nach Vergnügen und einigen Stunden Freiheit war daher im Dorf wohl auch eine als äquivalentes Recht verstandene Gegenreaktion auf die ständige familiäre Bevormundung, auf die kontinuierliche Unselbständigkeitserfahrung im Dorfalltag und auf die familiäre ‚Ausbeutung‘. Und obwohl diese Grenzgänge missbilligt und öffentlich gerügt wurden, akzeptierten Eltern und Ortsbehörden dieses Verhalten bis zu einem gewissen Grad wohl doch und betrachteten es als ein notwendiges Ventil, das den innerfamiliären und innerdörflichen atmosphärischen Druck einigermaßen erträglich hielt. Durch das „Auslaufen“ wurden allerdings auch fremde Sitten ins Dorf hineingetragen. (Kaschuba, S. 42f.)
Der Visitator schrieb aber auch, es „seye kein der Jugend gefährliches Haus im Orte“ und auch „Kunkelstuben gebe es nicht […]; der Wirtshausbesuch über die Zeit werde nicht geduldet; auch die Nachtschwärmerei nicht. Der Gassenbettel seye abgestellt.“ (DARott G 1.8, Nr. 472 (Pfarr-Visitation 1824))
Allerdings war „die Zahl der unehelichen Kinder seit der letzten Visitation um 4 gestiegen“ (DARott G 1.8, Nr. 472 (Pfarr-Visitation 1830)). Diese Zahl sollte in den folgenden Jahren weiter steigen – auch in meiner Familie lässt sich dies beobachten – und wurde von Seiten der Geistlichkeit beständig gerügt. Dieses Phänomen hing weniger mit den losen Sitten als vielmehr mit den strikten Eheschließungsgesetzen zusammen.
Wurde über mangelnde Sitten und Moral also noch in den 1820er Jahren kaum geklagt, änderte sich dies in den folgenden Jahrzehnten. Der Pfarrvisitationsbericht des Jahres 1842 rügt den „auf die Sitten der Dorfjugend nachteilige[n] Einfluss der nahegelegenen Stadt Rottenburg“ und nennt besonders die „Tanzereien, welche beinahe jeden Sonntag in Wurmlingen stattfanden“ einen „Unfug. Der Schultheiß [Zacharias Groß] versprach, dieselben abzustellen.“ (DARott G 1.8, Nr. 472 (Pfarr-Visitation 1842))
Weit über Wurmlingen hinaus waren offenbar die jungen und wohl auch sehr schönen Mädchen bekannt. Häufig wurden diese von ihren Ahnen in die Geheimnisse der Kräuterlehre eingeweiht. So wurden etwa gegen Hämorrhoiden am Kapellenberg Quitten gesammelt, gegen Verstauchungen, Prellungen, Rheuma sowie Hexenschuß verwendete man Johanniskraut und gegen Potenzstörungen half nur der Mönchspfeffer, der an einem Tümpel Richtung Wendelsheim wuchs.
„Wurmlinger Zucker“
Wurmlingen ist bekannt für seinen Gipskeuper (Tonmergel): Der weiße Fasergips wurde „Wurmlinger Zucker“ genannt und östlich und nördlich des Ortes ganze Gipslager ausgebeutet. Daneben wurde auch am Pfäffinger Weg Alabastergips gegraben.

Gipsgrube am Pfäffinger Weg

Das Schwäbische Tagblatt vom 29. Juli 2009 schreibt dazu:
„Das waren noch Zeiten … als im Ammertal „Gipsgräberstimmung“ herrschte. Gips, chemisch Calciumsulfat, liegt im Ammertal weit verbreitet unter einer Deckschicht von einem bis fünf Metern in einer Schichtstärke bis zu zehn Metern. Er wurde entweder bergmännisch abgebaut […] oder im Tagebau in Steinbrüchen, wie in Wurmlingen. […] Gips scheint eine banale Angelegenheit zu sein. Aber wenn man Namen hört wie […] „Wurmlinger Zucker“, beginnt man zu ahnen, dass mehr dahinter steckt. […] Der Abbau nahm einen steilen Aufschwung mit dem Bau der Ammertalbahn. Die Konkurrenz belebte nicht nur die Grundstückspreise, man versuchte sich auch gegenseitig auszustechen. […]
Der Bahnhof Breitenholz war ein wichtiger Umschlagplatz für Gips. Von Unterjesingen aus wurden vor dem Zweiten Weltkrieg täglich etwa 1000 Zentner „Wurmlinger Zucker“ in die Zementfabriken auf der Alb verschickt. Die Bahn war auch wichtig für das Herankarren der Kohle, die man beim Gipsbrennen brauchte. Nach dem Krieg nahm zuerst die Bedeutung der Bahn für den Gips ab, LkwTransport wurde üblich. Ende der 70er Jahre wurde der Abbau eingestellt. Steinbrüche, Schornsteine und Feldbahnen blieben als Spuren.“ (http://www.tagblatt.de /Home/nachrichten_artikel,-Das-waren-noch-Zeiten-%E2%80%A6-_arid,71569_ print,1.html (29.03.2015))
Die Wurmlinger Kapelle
Der Kapellenberg ist heute ein beliebtes Ausflugs- und Wallfahrtsziel. Von der am Fuß des Berges gelegenen Ortschaft führt ein 1687 errichteter Kreuzweg zur etwa 130 m höher gelegenen Kapelle hinauf, um die herum sich der Friedhof befindet, auf dem auch meine Großeltern Johann und Thekla Haug sowie mein Onkel Hans Haug bestattet sind.
Der romanische Vorgängerbau der Kapelle wurde im Jahr 1050 in der Amtszeit von Papst Leo IX. als Grabkapelle des Stifters Graf Anselm von Calw errichtet. Der Sage nach soll Anselm angeordnet haben, dass er nach seinem Tod auf einen von zwei Ochsen gezogenen Wagen gelegt werden solle. Dort, wo sie anhielten, solle seine Grabkapelle erbaut werden. Man vermutet jedoch, dass diese Ochsen nicht auf den Kapellenberg stiegen, sondern am Fuße haltmachten. Zum Gedenken an Graf Anselm von Calw wird der Wurmlinger Jahrtag in der Kapelle begangen.
Die romanische Krypta stammt aus der Zeit um 1150, der gotische Nachfolgebau brannte 1644 ab. Die bis heute erhalten gebliebene barocke Kapelle wurde 1685 eingeweiht. 1911 nahm der Kunst- und Kirchenmaler Carl Dehner eine Ausmalung der Kapelle vor.
In den Südhanglagen des Kapellenberges wird wohl seit dem 13. Jahrhundert Wein angebaut. „Der größte Fehler bei der hiesigen Erziehung“, schrieb Johann Philipp Bronner 1837, „ist aber der, daß die Zeilen oder Rebstöcke alle verkehrt geführt sind … Nach der natürlichen Regel sollen sie … nach der aufsteigenden Richtung des Berges geführt werden … hier ist aber gerade das Umgekehrte beobachtet, die Bögen sind nämlich alle so gestellt, dass sie eine ziemlich geschlossene grüne Wand bilden, die immer quer über den Weinberg läuft …“ Deshalb sieht man die Querreihen heute noch an der Wurmlinger Kapelle. Den Wein quer zum Hang zu ziehen hat den Vorteil, dass man ebenerdig durch die Reihen gehen kann, ohne über die Weinbergmauern klettern zu müssen. Weinberge mit Gras zu begrünen war früher gang und gäbe, weil man dadurch nicht hacken, sondern nur mähen musste, und die Begrünung wird heute wieder zunehmend eingesetzt.
Zu einem gewaltigen Erdbeben des späten Abends des 16. November 1911 auf der Westalb liest man in der Chronik der Königlichen Haupt- und Residenzstadt Stuttgart 1911 folgendes: „Um 10 Uhr 26 Minuten 16 Sekunden nachts […] kam, von brausendem Geräusch und unterirdischem Rollen begleitet, ein Stoß von einer in unsern Gegenden unerhörten Heftigkeit, der in der Richtung von Ostsüdost auch Westnordwest verlief, und dem um 3 Uhr 3 Minuten 45 Sekunden ein zweiter schwächerer nachfolgte.“ (http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.beben-auf-der-alb-panik-aber-keine-verletzte.be0ac4ec-2cb0-43e4-a076-c30bb367429c.html (30. 05.2015))
In der Chronik ist auch vermerkt, dass sich das Erdbeben etwa von Wien bis Besançon und Belfort und von Thüringen bis nach Italien erstreckte. Die Stärke des Bebens hatte eine Magnitude von 5,7 – auf der Richter-Skala wurde sogar der Wert 6,1 erreicht – und war das bis dato stärkste in Deutschland gemessene Beben!
1950 fand die 900-Jahr-Feier des Bestehens der Wurmlinger Kapelle statt, bei der meine Tante Erika Schütz (geb. Haug) mit einigen anderen Mädchen ein kleines Theaterstück aufführte.

Erika Haug (rechts im Bild)
Konfessionen in Wurmlingen
Traditionell katholisch, lebten im Jahr 1828 999 Katholiken in Wurmlingen – kein einziger Protestant! Dies änderte sich erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Noch vor dem Zweiten Weltkrieg herrschte in Wurmlingen ein großer Konfessionsunterschied: die überwiegende Mehrheit der Bewohner war – wie Familie Haug – römisch-katholisch, es gab nur siebzig evangelische Einwohner. Im Laufe des Krieges kam eine größere Anzahl Menschen als Flüchtlinge und Vertriebene nach Wurmlingen und die evangelische Gemeinde wuchs schnell, so dass 1950 bereits 331 evangelische Mitbürger im Ort lebten. Der für sie zuständige Pfarrer Länge aus Tuttlingen fuhr sonntags im Talar auf dem Fahrrad (oder Moped) nach Wurmlingen und erinnerte die Menschen daran, zum Gottesdienst zu kommen.
Das Verhältnis der katholischen Dorfbevölkerung zur protestantischen Minderheit lässt sich anhand der Pfarrvisitationsberichte rekonstruieren. 1871 heißt es: „Von Angehörigen anderer religiöser Bekenntnisse ist kein nachtheiliger Einfluß auf die Parochianer … bemerkbar.“ Der Kommentar über die ortsansässigen Katholiken fällt dagegen nicht so positiv aus: „Der sittliche und religiös-kirchliche Charakter der Gemeinde lässt sich im Allgemeinen als ein ziemlich trostloser bezeichnen. Gleichgiltigkeit im Glauben bis Unglauben … Sehnen und Streben nach Gütern dieser Welt.“ Sieben Jahre später wird 1878 von „etwa zehn Angehörigen der evangelischen Confession“ berichtet; deren Verhalten sei „correkt und […] diese Akatholiken [sind] ohne Einfluß auf das kirchliche und religiös-sittliche Verhalten der Pfarrgemeinde.“ 1889 gab es „mehrere protestantische Personen“, die eine freundliche Beurteilung erfuhren: „Sie leben friedlich dahin, und die meisten beteiligen sich sogar an dem katholischen Gottesdienste, an Rosenkranzgebet usw.“ Neben Protestanten in gemischten Ehen – meist mit katholischer Kindererziehung – gab es im Dorf auch komplett evangelische Familien: Etliche waren Schäfer wie etwa die Majer, Wetter oder Bährle, andere Schneider oder auch Schuhmacher wie die schon früh aus Entringen mit „gutem Prädikat“ zugezogene Familie Gamerdinger. Die aus Unterjesingen stammende Bäckerfamilie Roser wie auch andere einigermaßen gut situierte Protestanten holten ihre Gesellen, Knechte und Dienstmägde ausschließlich aus evangelischen Orten (Halloch, Pfäffingen, Pliezhausen, Mössingen, Pfullingen oder Öhringen) – der Schäfer Gottlob Bährle stellte jedes Frühjahr gleich mehrere Schafknechte ein.
Der evangelische Schmied Jakob Wolf betrieb eine Ein-Mann-Holzsägerei und Schleiferei mit Dampfbetrieb und besaß sogar die „Befugnis zur Lehrlingshaltung“. Im Alter wurden etliche Wurmlinger Protestanten außer durch Kartoffel- und Mehlverteilung der bürgerlichen Gemeinde auch von der „Privat-Armenkasse“ Rottenburg unterstützt.
Das „Summarische Steuervermögensregister“ gibt Auskunft darüber, dass neben den Wurmlinger Katholiken auch etliche jüdische Bürger aus Baisingen und Nordstetten sowie einige protestantische Dorfbewohner Haus- und Grundbesitz im Ort hatten. Viele Evangelische lebten allerdings weit unter dem Existenzminimum, wie etwa ein kinderreicher Schneider, der mit seiner Familie im Armenhaus untergebracht war. Als er wegen Überfüllung aus dem Armenhaus ausziehen sollte, nahm ihn niemand aus dem Dorf auf, so dass das Erdgeschoß der Armenunterkunft ausgebaut und ihm samt einem hellen Platz zum Nähen zur Verfügung gestellt wurde.
Laut Kirchenkonventsprotokoll vom 15. Dezember 1881 hatte im Übrigen der katholische Mesner „für jede Begleitung – ob Taufe, Trauung oder Beerdigung – des Geistlichen in die Diaspora 1 Mark 50 zu beanspruchen“; wenn die Familie zu arm war, leistete die Kirchenpflege eine Entschädigung von einer Mark, was bei den Besuchen in Wurmlingen fast immer nötig war. Die Konfirmanden mussten zum winterlichen Blockunterricht in die Stadt, wo sie im 19. Jahrhundert noch in den Familien der evangelischen Gemeindemitglieder verköstigt wurden. Ab 1882 wurde für die Diasporakinder gesammelt und eine gemeinsame Mittagskost finanziert.
Schulleben und Schulaufsicht in Wurmlingen von der frühen Neuzeit bis zum 19. Jahrhundert
Eine Reform-Errungenschaft von Kaiser Joseph II. (der 1765 bis 1780 in Österreich zusammen mit seiner Mutter Maria Theresia und 1780 bis 1790 allein regierte) war 1774 die »Allgemeine Schulordnung« mit einer Normalschule als Kern des neuen Unterrichtswesens. Dort wurden die Fächer Latein, Naturlehre, Feldmeß- und Baukunst, Mechanik und Zeichnen unterrichtet. Auch zukünftig Lehrer mussten diese Schulen besuchen. In allen größeren Städten Vorderösterreichs gab es die Hauptschule, auf dem Dorf die Trivialschule. Diese musste von der Gemeinde unterhalten werden. Soweit die amtliche Planung. Im kleinen Wurmlingen gab es eine Normalschule.
Lehrer wurden schlecht bezahlt, oft bekam am jährlichen Stich- und Zinstag zu Martini (11. November) derjenige die Stelle, der mit der geringsten Entlohnung zufrieden war. Viele Lehrer versuchten, ihre Einkünfte zu verbessern, indem sie Nebeneinkünfte erzielten – nicht immer ganz legal. Der Fall des Bürgers, ehemaligen Meßners und Schulmeister Karle Schaible, der im Herbst 1777 einen beträchtlichen Weinbetrug an der Herrschafft und Kreuzlingen begangen hatte und daraufhin entlassen wurde, verdeutlicht dies. (Frahm, Die Chronik des Schultheißen Birlinger (1770 – 1796), S. 106.)
Wenn der amtliche Kelternknecht ein Auge zudrückte, meldete man also entweder der Herrschaft (Grafschaft Hohenberg bzw. Oberamt Rottenburg) oder dem kirchlichen Zehntherrn (Kloster Kreuzlingen) nach der Weinernte einen geringeren Ertrag, bezahlte somit weniger Abgaben und verkaufte den Mehrertrag auf dem Markt. Oder man übte Weinbetrug, indem man dort Wein erntete und dann verkaufte, wo man geringer besteuert wurde, beispielsweise auf Wiesen oder Ackerland. Die Meßner – aus diesem Amt gingen die ersten Lehrer hervor – hatten noch eine andere Verdienstmöglichkeit: Als Assistenten des Pfarrers erhielten sie neben gewissen Bezügen auch die Nutznießung des Friedhofs und konnten dort Obstbäume und Gemüse pflanzen.
Im Jahre 1786 standen Umbauten in Bezug auf das Wurmlinger Schulhaus an, wie man der Chronik des Schultheißen Anton Birlinger entnehemen kann. Er berichtet, dass die Gemeinde zwar bereits über 600fl. für das Schulhaus der Normalschule aufgewandt habe, die Schulvisitatoren allerdings dennoch anordneten, das Schulhaus baulich völlig zu verändern. So sollte die sich im Ergeschoß befindliche Schulstube nach oben verlegt und die sich dort befindliche Wohnung des Mesners unten eingerichtet werden. Zusätzlich wurde der Dachgibel erneuert sowie das ganze Haus außen ordentlich verputz, wofür die Gemeinde noch einmal 600 fl. benötigte. (Frahm, Die Chronik des Schultheißen Birlinger (1770 – 1796), S. 110.)
Nach der Gründung des württembergischen Königreichs 1806 galten in Wurmlingen die württembergischen Bestimmungen für die Dorfschulen. In den Schulordnungen von 1808 und 1810 schlugen sich neue pädagogische Ideen nieder, der Unterricht in den Volksschulen sollte inhaltlich verbessert werden, doch dagegen regte sich staatlicher und kirchlicher Widerstand. Am 1. Februar 1812 erging eine königliche Resolution: „Wir befehlen ausdrücklich, daß bei jedem Lehrplan alles, was auf die Pestalozzische Methode, welche wir nun ein für allemal in öffentlichen Instituten nicht eingeführt wissen wollen, hindeuten würde, durchaus vermieden würde.“ (Zitiert nach Gerd Friedrich, Die Volksschule in Württemberg im 19. Jahrhundert. Diss., Weinheim 1978, S. 25. Der Schweizer Johann Heinrich Pestalozzi (1746 – 1827) gilt als Begründer der Pädagogik und als Propagandist einer allgemeinen Bildung für alle Menschen und machte sich als Philanthrop, Schul- und Sozialreformer, Philosoph sowie Politiker einen Namen.
Für die Mehrheit der Kinder bot der Schulalltag in der ländlichen Zwergenschule nur ein niedriges Unterrichtsniveau in viel zu großen Klassen. Obwohl die hygienischen Verhältnisse miserabel und die Lehrer in Wurmlingen nicht gut ausgebildet waren, gelang in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts drei Mitgliedern der Familie Haug nach dem Besuch der Elementarschule der Wechsel auf die Lateinschule nach Rottenburg: die jüngsten Söhne von Johannes Evangelist Haug (1784 – 1865) und Magdalena Sauter (1784 – 1860), Lorenz Haug (1818 – 1856), Jakob Haug (1824 – 1878), und Lukas Haug (1829 – 1901). Dies war schon allein deshalb erstaunlich ist, da sich die Lebensplanung von Eltern und Kindern in Wurmlingen normalerweise nicht an hehren Bildungszielen, sondern an der harten Realität des kärglichen Daseins auf dem Land orientierte. Der weitere Lebensweg führte die drei jungen Männer aus der dörflichen Enge in die weite Welt hinaus: Lorenz Haug als Lehrer für hör- und sehbehinderte Kinder nach Gmünd, Jakob Haug, ebenfalls Lehrer für hör- und sehbehinderte Kinder, über Stuttgart, Neresheim und Gmünd nach Schlettstadt ins Elsass und schließlich Lukas Haug, der zur Vorbereitung auf ein Jurastudium gar das Internat in Ehingen besucht hatte, als gräflichen und fürstlichen Erzieher in die Länder der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie sowie als Archivrat ins Fürstentum Liechtenstein und schließlich nach Wien.
Dies war jedoch die große Ausnahme. Die meisten Kinder besuchten die Schule nur unregelmäßig, und häufig konnten die Volksschullehrer nur die einfachsten Grundkenntnisse vermitteln. Im Zuge der neuen württembergischen Volksschulgesetze von 1836 wurden im ganzen Königreich 600 neue Lehrerstellen geschaffen und 500 neue Schulgebäude gebaut. Seit dem Volksschulgesetz von 1836 war auch in Württemberg ein Fächerkanon verpflichtend, der Lesen, Schreiben, Rechnen, Religion, Singen und Sittenlehre beinhaltete. Der Schulbesuch war für alle Kinder vom sechsten bis zum 14. Lebensjahr vorgeschrieben, doch diese mussten ihren Familien auch auf dem Feld (bei der Erntearbeit oder bei sonstigen landwirtschaftlichen Tätigkeiten helfen), vor allem jene Kinder, deren Familien – wie in Wurmlingen häufig – neben einem handwerklichen Beruf eine Nebenerwerbslandwirtschaft betrieben und jede Arbeitskraft dringend benötigten. (Michaela Häffner, Von der ländlichen Volksschule zur modernen Grundschule. In: Karlheinz Geppert (Hg.): 900 Jahre Wurmlingen – Vom Dorf am Fuße der Kapelle. Rottenburg am Neckar und Wurmlingen 2000, S. 233.) Immerhin lernten vor der Revolution von 1848/49 nun über 80 Prozent der württembergischen Kinder Lesen und Schreiben, und nach der Gründung des deutschen Kaiserreichs 1870/71 besaßen annähernd alle Kinder zumindest die einfachsten Grundkenntnisse.
Lehrer und Lehrgehilfe übten ihre Funktion in Wurmlingen hauptberuflich aus. Der seit 1871 tätige Dorflehrer Rudolf Biesinger bezog von der Gemeinde ein jährliches Gehalt von etwa 1000 Mark[2] (im Schuljahr 1880/81 genau 1035,72 M), Heizmaterial und Naturalien und lebte mietfrei in einer Dienstwohnung. Biesinger war verheiratet mit Appolonia Fuhrer, der Tochter des Schmieds Simon Fuhrer und der Maria Anna Biesinger. (StAR-C170-2, Karton 67, Tagebuch-Nr. 0091 Realteilung Wurmlingen T 20-0050 1896))
Wie damals für einen Lehrer selbstverständlich, lebte er nicht nur in dem Dorf, in dem er unterrichtete, sondern nahm im Schulgebäude selbst seine Wohnung. Landlehrer verdienten im Vergleich zu ihren Kollegen in der Stadt sehr wenig, auch wenn sich ihre Situation aufgrund neuer Vorschriften in den 1870er Jahren verbesserte. Man kann außerdem davon ausgehen, das Biesinger nicht nur für die Schüler zuständig war, sondern auch die Aufgaben eines Hausmeisters versah und im Winter beispielsweise morgens die Klassenzimmer heizte (Häffner, S. 236.); er versah aber nicht mehr wie seine Vorgänger die Mesnerdienste, die den Dorflehrern gemeinhin als Zubrot gedient hatten. 1872 wurde die mehrklassige Schule zur Regel erhoben: die Klassenstärke sollte künftig unter achtzig Schüler/Innen liegen. Doch Dorflehrer Biesinger war nicht zu beneiden: im Schuljahr 1880/81 trug er für genau 175 Schülerinnen und Schüler der Wurmlinger Volksschule die Verantwortung, auch für die Sonntagsschüler. (StAR C 170, R 440: Rechnungen 1880/81; Schreiben Bisingers an den Stiftungspfleger Groß vom 4.3.1881) Biesinger wurde vom Lehrergehilfen Schmid unterstützt, der als Hilfslehrer mit nur 500 Mark Besoldung im Jahr auskommen musste. (StAR C 170, R 440: Rechnungen 1880/81) Das Gehalt des Lehrers bzw. Hilfslehrers wurde bis 1888 durch das Schulgeld finanziert (Hans-Ulrich Wehler, Von der deutschen Doppelrevolution bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs 1849 – 1914. München 1995, S. 399.), das die Eltern der Volksschüler bezahlen mussten, danach kam die Gemeinde aus Steuergeldern dafür auf. (Häffner, S. 236.)
Die Schulaufsicht über die Volksschulen führten der Pfarrer, der Kirchenkonvent und – als Oberschulbehörde – der katholische Kirchenrat, außerdem wurden von staatlicher Seite in unregelmäßigen Abständen oberamtliche Gemeindevisitationen in den Schulen durchgeführt. Für Wurmlingen sind von diesen behördlich durchgeführten Kontrollen handschriftliche Protokolle überliefert, in deren Rahmen die zuständigen Beamten öffentliche Gebäude – neben der Schule beispielsweise auch das Rathaus – auf ihren baulichen Zustand überprüften. Bei dieser Gelegenheit wurden auch die beiden Wurmlinger Gemeindebadewannen sowie die Gemeindebackstube in Augenschein genommen. Beurteilt wurde die gesundheitliche und hygienische Situation von Mensch und Tier, wozu zum Beispiel auch die Straßenbefestigungen gehörten. Die Anforderungen waren allerdings gemessen an heutigen Standards nicht allzu hoch, was am schlechten Zustand der Volksschule deutlich wird, der in den Visitationsprotokolle, die in Wurmlingen erstmals für die Jahre 1894 und 1898 vorliegen, dokumentiert ist. (StAR C 170, A 41: Protokolle über die oberamtlichen Gemeindevisitationen 1894 bis 1926, handschriftlich und gebunden; hier: Protokoll vom 1.11.1898 über die Visitationen am 14./15.7.1898.) Hierin finden sich folgende vom Oberamt beanstandete Mängel bzw. konkrete Anweisungen, wie diese zu beseitigen seien:
„§ 36: Die Schulzimmer sind, sobald es die Jahreszeit gestatte, frisch zu tünchen – und künftig mindestens alle zwei Jahre. Den Wänden ist ein blaugrauer oder grünlichgrauer giftfreier Anstrich zu geben, der Decke ein weißer.
- 37: […] Die Ventilationsvorrichtung in beiden Schulklassen ist besser zu handhaben. Die Klappen des Ventilationskamins müssen im Winter offen und oben geschlossen, im Sommer dagegen oben offen und unten geschlossen sein. Auch sind dieselben von Staub zu reinigen. (Solche akribisch ausgeführten Details wiederholen sich in den Protokollen bis weit ins 20. Jahrhundert.)
- 38: Den Lehrern ist aufzugeben, die regelmäßige Leerung der Abortgrube und dessen Desinfektion (2mal wöchentlich), sowie die sonstige Reinhaltung der Aborte gemäf § 27 der Ministerialverfügung vom 28. Dezember 1870 nachdrücklich zu überwachen, ebenso die Vorschriften über die Reinhaltung der Schulzimmer.
- 39: Den Lehrern wird empfohlen, sich mit den Ausführungen über die Körperhaltung der Schulkinder […] ausführlich zu beschäftigen und die Vorschriften genau einzuhalten.“
Insgesamt scheint die Schule in einem sehr schlechten Zustand und außerdem viel zu klein für Schüler gewesen zu sein: „Seit Jahren wird die Anschaffung neuer [Bänke] für die Schulzimmer hinausgeschoben. Hier stellt sich heraus, daß die Schulsäle überhaupt zu klein sind, und der [Umbau] dringend angezeigt ist“, so das handschriftliche Protokoll für 1894. Erst vier Jahre später fiel diesbezüglich eine endgültige Entscheidung: „Die Schulzimmer sind völlig ungenügend, es bleibt daher nichts anderes übrig, als ein neues Gebäude mit 2 Schulzimmern zu erbauen.“ (StAR C 170, A 41: Protokolle über die oberamtlichen Gemeindevisitationen 1894 bis 1926, handschriftlich und gebunden; hier: Protokolle vom 16.4.1894 und 1.11.1898.)
Viele meiner direkten Vorfahren und Mitglieder aus den unterschiedlichen Zweigen der Familie Haug besuchten also die Volksschule Ende des 19. Jahrhunderts zu einer Zeit, als die Zustände wie oben beschrieben äußerst schlecht waren. Zu nennen sind hier die Kinder der Ururgroßeltern Karl Haug (1846 – 1878) und seiner Ehefrau Katharina Schäuble (1846 – 1888), nämlich Urgroßvater Jakob (1870 – 1942) sowie seine spätere Ehefrau Rosa Hess (1875 – 1924), Jakobs jüngerer Bruder Joseph (1876 – 1915) und auch der jüngste Bruder des Urgroßvaters, Johannes Haug (* 1878).
Auch die Kinder von Johannes Baptist Haug (1842 – 1927) und Kreszentia Müller (* 1846) waren unter den vielen Schulkindern dieser Jahre, beispielsweise Joseph (1868 – 1940) und seine elf Geschwister Pius (1874 – 1932), Pauline (* 1875), Eleonora (* 1879), Anna (1880), Maria Idda (* 1884), Magdalena (* 1885), Lukas (1886 – 1901), Franz Xaver (* 1887), Michael (* 1889) und Elisabeth Haug (* 1891). Bis auf Joseph Haug, der als Präzeptor in Tübingen wirkte, wanderten im Übrigen alle genannten Geschwister nach und nach in die USA aus, ebenso die Eltern.
Zacharias Haug (1844 – 1925) und seine Frau Maria Maier (1846 – 1916) mussten neun Kindern den Schulbesuch in Wurmlingen finanzieren: Magdalena (* 1865), Philomena (* 1868), Anna M. (* 1870), Pauline (* 1873), August (* 1874), Rosina (* 1876) und Anton Haug (* 1885). Drei der Geschwister wanderten wie zehn ihrer Cousins und Cousinen in die USA aus.
Das Oberamt Rottenburg entschied, im Jahr 1902 ein neues Schulhaus mit zwei Klassenzimmern für 100 Schüler zu bauen, das die Gemeinde finanzieren musste. Lehrer Biesinger konnte mit dem nun helleren und wärmeren Schulhaus zufrieden sein, in dem er ab 1903 zusammen mit dem Hilfslehrer für zwei Schulklassen mit immerhin 123 SchülerInnen verantwortlich war. Fünf Jahre später betrug die Klassenstärke der Unterklasse (Schuljahr 1 – 4) bereits 76 und die der Oberklasse (Schuljahr 5 – 8) 78, sie war also auf insgesamt 154 Schüler/Innen angewachsen. Eines der in diesem Jahr unterrichteten Kinder war meine Großtante Maria Haug (* 1902), die älteste Schwester meines Großvaters Johannes Haug. Ihre Cousine Maria Idda Haug (* 1900), die Tochter von August Haug (* 1874) und Ursula Higi (* 1875), drückte zu dieser Zeit ebenfalls die Schulbank im neuen Schulhaus.
Biesingers Besoldung hatte sich, da er inzwischen Oberlehrer geworden war, auf 2400 Mark pro Jahr erhöht. (StAR C 170, A 113, Verwaltungsakten, III: Kirchen und Schulanstalten. Dieses Gehalt bezog Bisinger seit 1905; es setzte sich aus dem Grundgehalt von 1100 Mark und einer staatlichen Dienstalterszulage von 1300 Mark zusammen.) Erstaunlicherweise verringerte sich die Anzahl der Mängel bei weiteren Visitationen nicht wesentlich, doch dank des Neubaus waren sie nicht mehr so gravierend und leichter zu beheben. Bei der Visitation von 1903 kamen hauptsächlich hygienische und gesundheitliche Aspekte zur Sprache. So sollte „der Fußboden der beiden Schullokale zur Vermeidung bzw. Verringerung der Staubentwicklung“ regelmäßig mindestens dreimal jährlich „mit einem staubbindenden Öle imprägniert werden“. Das benutzte Öl bewirkte fortan einen typischen „Schulgeruch“. Die Beamten des Oberamtes ermahnten zu einer allgemein gründlicheren Schulreinigung, auch hätten die Schüler vor Betreten der Räume ihre Schuhe gehörig zu reinigen. Beim Unterricht selbst sollte mehr auf die Lichtverhältnisse geachtet und zum Beispiel die Tafel durch Jalousien vor Licht geschützt werden. Hinsichtlich der Sitzordnung der Schüler wurde der Lehrer angehalten, bei der Auswahl des Platzes und der Schulbank das Alter und die Größe der Schüler zu berücksichtigen. Dies scheint alles befolgt worden zu sein, zumindest wird im Visitationsprotokoll drei Jahre später die Schule nicht erwähnt, woraus zu schließen ist, dass es keinen Grund zu klagen gab.
Johannes Kopp (1748 – 1815)
Im Frühjahr 1748 wurde im schwäbischen Wurmlingen am Fuße des Spitzberges mein Vorfahr Johannes Kopp geboren. Er ist mein Urururururgroßvater. Von seiner seiner Urenkelin Genovefa Baur – meiner Ururgroßmutter – gibt es sogar ein Foto!
Der Sohn von Jacob Kopp und Magdalena Bondizin kam am 9. April zur Welt und wurde, wie damals üblich, noch am selben Tag von Pfarrer Petrus Schmid römisch-katholisch getauft. Da die Kindersterblichkeit außerordentlich hoch war, war die Taufe der erste wichtige Akt im Leben eines Neugeborenen. Eile war geboten – ein ungetauftes Kind kommt nach katholischer Lehre nicht in den Himmel, sondern ist ewiger Verdammnis und Höllenqualen ausgesetzt – weshalb die Taufe bereits am ersten (seltener am zweiten) Lebenstag erfolgte. Erst ab dem Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Neugeborenen am Sonntag nach der Geburt getauft.
Eine Taufe lief in Wurmlingen wohl schon im 18. Jahrhundert folgendermaßen ab:
„[…] Die „Täufe“ wurde wenige Tage nach der Geburt am Sonntag in der Kirche im Anschluß an die Christenlehre nach dem morgendlichen Gottesdienst um 11 Uhr oder nachmittags nach der „Vesper“ vollzogen. [Der Taufzug setzte sich aus den Eltern des Kindes, dem Dötte und der Dotte und einigen nahen Verwandten zusammen.] Die Paten […] blieben bei sämtlichen Kindern die gleichen. Da früher sehr viele Kinder geboren wurden, waren auch die Geschenke sehr bescheiden. Der Dötte schenkte 1 oder 2 Mark, die Dotte 1 Flasche Wein oder etwas Süßes oder etwas zum Anziehen für das Kind. Der Name des Kindes wurde größtenteils nach dem Namen eines nahen Verwandten, den Großeltern, oder nach dem Namen eines in den Tagen gefeierten Kalenderheiligen gegeben. Nach der Taufe wurde mit Böllern […] geschossen. War die Taufe morgens, so gab‘s nachher zu Hause die „Taufsuppe“ – bestehend aus Rindfleisch mit Suppennudeln und Kartoffelsalat. […] Nachmittags trank man Kaffee mit süßem Weißbrot, Hefekranz oder Gugelhupf, manchmal auch Böten, einen viereckigen Hefeobstkuchen.“
Zitiert nach Klara Leins in: Wurmlingen … es war einmal. Stadtteile der Großen Kreisstadt Rottenburg a.N. Horb 1989, S. 14.
Die Lebensdaten von Johannes Kopps Eltern, der Beruf des Vaters oder die Anzahl seiner Geschwister sind bislang noch nicht erforscht, über die Kindheit und Jugend Johannes Kopps können daher nur sehr wenige Aussagen getroffen werden
Als Kind besuchte Johannes die Volksschule bei Lehrer Karl Bonditz dem Jüngeren, der von 1736 bis 1761 in Wurmlingen als Lehrer wirkte. Mit Sicherheit nahm Johannes im Alter von etwa neun Jahren das erste Mal an der Heiligen Kommunion teil und wurde zum Ende seiner siebenjährigen Volksschulzeit gefirmt.
Eine längere Schulzeit war für die meisten Dorfkinder nicht vorgesehen, im Alter von 13 oder 14 Jahren erlernten sie ein Handwerk oder waren als Bauern oder Weingärtner in der Landwirtschaft tätig. Nur sehr wenige Kinder kamen in den Genuss einer höheren Schulbildung und besuchten etwa die Lateinschule (Gymnasium) in Rottenburg.
In meiner Familie sind mindestens zwei Jungen bekannt, die in Rottenburg lernten, nämlich die Brüder Lorenz und Jakob Haug, die später Lehrer für taubstumme Kinder wurden. Ihr jüngerer Bruder Lukas Haug besuchte gar das Gymnasium bzw. Internat in Ehingen, das ihn auf ein Studium der Jurisprudenz vorbereitete und der später als fürstlicher Erzieher und Archivrat in Liechtenstein wirkte. Über alle drei hochgeachteten Männer werde ich noch ausführlich berichten.
Doch zurück zu Johannes Kopp. Im Alter von 30 Jahren heiratete er am 1. Juni 1778 Maria Sießin (1752 – 1822), die am 28. Januar 1752 als Tochter von Matthias Sieß und Anna Maria Theurerin ebenfalls in Wurmlingen zur Welt gekommen und von Pfarrer Franz Xaver Vogt getauft worden war. Bei der Hochzeit war die Braut somit 26 Jahre alt. Pfarrer Antonius Lutz traute das Paar in der St. Briccius Kirche Wurmlingen. Es wurde mindestens der Sohn Engelbert Kopp (1780 – 1851) geboren, der von Pfarrer Melchior Hammer oder Pfarrer Prosper Probst getauft wurde. Über weitere Kinder ist noch nichts bekannt, Engelbert war aber mit Sicherheit kein Einzelkind.
Johannes Kopp starb am 27. August 1815. Das Begräbnis auf dem Friedhof oben auf dem Wurmlinger Kapellenberg nahm Pfarrer Paul Frey vor. Johannes Kopps Witwe Maria Sieß lebte nach seinem Tod noch sieben Jahre und verstarb mit 70 Jahren am 1. Oktober 1822. Sie wurde von Weltpriester Johann Evangelist Hunger ebenfalls auf dem Friedhof bei der Wurmlinger Kapelle begraben.
Johannes und Marias Sohn Engelbert Kopp war Bürger, Weingärtner und elffacher Vater in Wurmlingen. Sein sechstes Kind war die Tochter Maria Kopp (1815 – 1884), die 1836 mit 19 Jahren Remigius Hess (1800 – 1868) heiratete. Das fünfte der acht Kinder dieses Paares war der Bauer und Schuster Johannes Hess (1843 – 1910). Dieser heiratete Genovefa Baur (1846 – ?) und bekam fünf Kinder. Die zweitgeborenen Tochter Rosa Hess (* 26. August 1875) ist meine Urgroßmutter, die Mutter meines Großvaters Johannes Haug und Großmutter meines Vaters Günter Haug.
Genovefa Baur – meine Ururgroßmutter
Genovefa Baurs väterliche Vorfahren lassen sich in Wurmlingen bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts zu Johannes Baur, einem ihrer Ururgroßväter, und seinem Eheweib Katharina Großin zurückverfolgen. Genovefa selbst wurde zu Beginn des Jahres 1846 am Fuße des berühmten Wurmlinger Kapellenberges geboren.
Über Genovefas Urahn Johannes Baur ist noch nicht viel erforscht, die Kirchenbücher werden sicher noch weitere Daten zu Tage fördern. Sein zu Beginn des Jahres 1742 geborener Sohn Johannes Baur (1742 – 1808) ging beim Wurmlinger Dorfschullehrer Karl Bonditz dem Jüngeren zur Schule. Johannes war Bürger in Wurmlingen und heiratete am 17. August 1766 die Wurmlingerin Marianna Birlingerin († 1808). Marianna war eine Tochter von Martin Birlinger (1704 – 1760) und Galina Hartmann (1722 – 1767).
Genovefas Großvater väterlicherseits, Eugenius Baur (1778 – 1841) genannt Eugen, kam als zweites von mindestens drei Kindern des Johannes Baur sen. und der Marianna Birlingerin zur Welt und besuchte beim Schneider und Lehrer Johannes Merk die Dorfschule. Eugen war Bürger und wohl Bauer in Wurmlingen und heiratete Cäcilia Schäuble (im Kirchenbuch „Zäzilia“ geschrieben; 1778 – 1853), eine Tochter von Johannes Schäuble und Judith Martin. Mit 63 Jahren starb Eugenius Baur am 14. April 1841. Seine Witwe Cäcilia Schäuble wurde 75 Jahre alt und verstarb am 30. Mai 1853. Ihre Erben waren die Kinder Joseph (Weingärtner), Theresia (ledig), Eleonore (verheiratet mit dem Steinhauer Joseph Wachendorfer) und Brizius Baur.
Genovefas Vater Brizius Baur (1817 – 1902), am 10. November 1817 als jüngstes Kind der Familie Baur zur Welt gekommen, hatte drei ältere Geschwister (Johannes (1809 – 1839) und Franziska (1811 – 1876); über das drittgeborene Kind ist nichts bekannt) und besuchte sieben Jahre lang die Wurmlinger Dorfschule bei Lehrer Kasimir Birlinger. Der ledige junge Mann, seit dem Ende seiner Schulzeit mit etwa 14 Jahren als Maurer bzw. Steinhauer tätig, heiratete am 27. Februar 1849 die ebenfalls ledige Tochter des Bürgers und Bauers Joseph Sieß und seiner Ehefrau Maria Mayer, Katharina Sieß (1816 – 18 53). Der Wurmlinger Pfarrer Johann Köhle vollzog die Trauung; die Namen der Trauzeugen sind im Copulationsbuch nicht zu entziffern.
Schon vor der Eheschließung waren die ersten fünf Kinder des Paares geboren worden! Auch meine Ururgroßmutter. Offenbar hatte der Wurmlinger Gemeinderat zunächst keine Heiratsgenehmigung für Brizius und Katharina erteilt. Generell hatte nur ein Bürger das Recht in der Gemeinde zu wohnen, das Wahlrecht auszuüben, ein Gewerbe zu betreiben oder zu heiraten. Wollte man zwischen 1828 und 1876 in Wurmlingen heiraten, musste man, bevor man den Pfarrer um den kirchlichen Segen bitten konnte, beim Gemeinderat um die Heiratserlaubnis nachsuchen, denn der Heiratskandidat war verpflichtet, einen „genügenden Nahrungsstand“ vorzuweisen – das Einkommen für die zu gründende Familie musste also gesichert sein, denn in Württemberg durfte nur heiraten, wer Arbeit und Auskommen hatte und nachweisen konnte, dass er in der Lage war, Kinder zu ernähren. So hatten die Wurmlinger „bürgerlichen Kollegien“ unter Schultheiß Johannes Baptist Haug im August 1847 beispielsweise dem Bürgersohn Leo Merk, der Magdalina Beiter aus Bierlingen heiraten wollte, zunächst die Heiratserlaubnis verweigert, da er als Schneidermeister einen brotlosen Beruf ausübte. Die Räte meinten, dass „ein Schneider […] dahier sowohl als Meister wie als Geselle nichts mehr und nichts weniger als ein Tagelöhner [sei]“. Am 11. Januar 1848 konnte diese Eheschließung aber schließlich doch erfolgen. Gelegentlich wurde die Heiratserlaubnis aber auch verweigert, wenn der Kandidat für seinen „notorischen Hang zum Trunk“ bekannt war.
Der oben genannte Schultheiß Johannes Baptist Haug ist Teil der in Wurmlingen weit verzweigten Familie Haug. Über ihn werde ich noch Interessantes berichten.
Die Ereignisse im Revolutionsjahr 1848/49 nahm die württembergische Regierung jedenfalls zum Anlass, die Ehebeschränkungen von 1833 noch zu erweitern: nun musste ein Heiratswilliger den „Besitz eines rechtmässigen Erwerbszweigs“ inklusive der nötigen Werkzeuge und ein kleines Vermögen von 150 Gulden nachweisen. Außerdem konnte die Heiratsbewilligung einem „offenkundig schlechten Haushälter“ verweigert werden. Diese Bestimmungen wurden nun auch auf die Braut angewendet. Die Ehebeschränkungen in Württemberg endeten erst am 1. Januar 1871, abgelehnt wurden die Ehegesuche aber nur in etwas mehr als 6 % der Fälle.
In Wurmlingen konnten also einige junge Leute aus Gründen der Mittellosigkeit nicht in den Stand der Ehe treten. Die Folgen, unehelich Geburten nämlich – die Quote der unehelichen Geburten betrug in Württemberg in den 1850er Jahren ca. 17 % – betrachtete man als Unzuchtvergehen. Wer dessen überführt wurde, musste je nach Anzahl der unehelichen Geburten einen oder mehrere Tage im Ortsarrest verbringen. Die Gemeinde hatte kein Interesse an einer großen Zahl von armen Bewohnern, denn wer in Wurmlingen das Heimatrecht besaß und in Armut und Not geriet, hatte Anspruch auf öffentliche Unterstützung, das sogenannte Armenzölibat; das 1847 von der Gemeinde für mittellose Einwohner erworbene Armenhaus stand „Auf der Laiber Nr. 12“ und diente der Unterbringung „unbehauster“ Armer. Im Armenhaus sollten die Bewohner gegen öffentliche Unterstützung übrigens auch arbeiten. Über den völlig mittellosen Bewohner des Armenhauses Ludwig Hess, der am 31. Dezember 1860 im Alter von 66 Jahren starb, ist bekannt, dass er „kein Vermögen [besaß], sondern […] seit mehr als 12 Jahren auf Kosten der Gemeinde unterhalten“ wurde.
Möglicherweise war auch Genovefas Vater Brizius Baur als Steinhauer zunächst nicht in der Lage, das verlangte Vermögen vorzuweisen, um zu heiraten. Und doch hatte er bereits vor der genehmigten Hochzeit viele Mäuler zu stopfen. Genovefa, genannt Genove, stammte nämlich wie damals üblich aus einer kinderreichen Familie. Die Kindersterblichkeit war allerdings im 19. Jahrhundert auch in Wurmlingen außerordentlich hoch: Von 202 Kindern, die beispielsweise zwischen 1892 und 1897 im Dorf geboren wurden, starben mehr als ein Drittel (nämlich 64 Säuglinge) während des ersten Lebensjahres, was möglicherweise einer falschen Ernährung in den ersten Lebensmonaten zuzuschreiben ist.
Meine Ururgroßmutter Genovefa Baur erblickte das Licht der Welt am 28. März 1846 und besuchte die Dorfschule bei Lehrer Joachim Biesinger. Ihr älterer Bruder Bruno (1842 – 1917) war erst nach der Hochzeit legitimiert worden. Der Älteste wurde wie der Vater Maurer und heiratet 1870 die Tochter des Wurmlinger Bauern Vinzenz Ehing und der Barbara Rauscher, Maria Anna Ehing.
Neben den zwei älteren Schwestern Cäcilia (1843 – 1921) und Carolina hatte Genovefa auch noch fünf jüngere Geschwister, von denen jedoch nur eine Schwester überlebte: Der jüngere Bruder Willibald starb 1847 am Tag seiner Geburt, der 1849 geborene Kaspar als Säugling „d. 7. Juni“ im Alter von 28 Wochen. Als Todesursache ist im Sterbbuch „Gichter“ vermerkt. Gichter(n) wurde häufig als Todesursache bei Kindern angegeben und war eine Erkrankung mit Krämpfen, hohem Fieber und Schüttelfrost, deren Ursache eine Darmerkrankung (Durchfall und Erbrechen) war, wodurch es zu Austrocknung, Mineralienmangel und Kräfteverfall der Säuglinge oder Kleinkinder kam. 1850 wurde noch Genovefas Schwester Maria Anna (1850 – 1908) geboren, doch die beiden jüngsten Geschwister Jacobus (*/† 1852) und „Anonymus“ (*/† 1853; Todesursache: „Schwäche“) starben bald.
Genovefas Mutter Katharina Sieß hatte in elf Jahren neun Kinder geboren. Wohl bei oder kurz nach der Geburt des letzten Kindes starb sie mit 36 Jahren im Juli 1853. Katharinas Erben waren der Witwer Brizius Baur und die fünf lebenden minderjährigen Kinder Bruno (11 Jahre), Cäcilia (9 Jahre), Carolina (8 Jahre), Genovefa (7 Jahre) und Mariana (3 Jahre).
Brizius Baur, im Alter von 35 Jahren Witwer geworden und Vater von fünf Kindern, die versorgt werden wollten, verehelichte sich nun schnell wieder: Noch vor Ablauf eines Trauerjahres heiratete er am 27. Februar 1854 eine Tochter des Wurmlingers Joseph Sieß und seiner Frau Maria Maier. Bereits 25 Jahre vor seinem Tod überschrieb Brizius 1877 sein Vermögen an die Kinder Bruno (Maurer), Cäcilia (ledig), Karolina (ledig), Genovefa (verheiratet mit Johannes Heß) und Maria Anna (Ehefrau von Andreas Leins). Brizius Baur überlebte seine erste Ehefrau und Mutter seiner Kinder Katharina Sieß um fast 50 Jahre und starb am 10. Dezember 1902 im Alter von 85 Jahren.
Da war die 56jährige Genovefa längst selbst verheiratet und Mutter von fünf Kindern. Ihr Ehemann Johannes Hess (1843 – 1910), ein Sohn von Remigius Hess (1800 – 1868) und Maria Koppin (1815 – 1884), war Bauer und Schuster in Wurmlingen und hatte seine drei Jahre jüngere Braut am 21. Oktober 1873 geheiratet. Die älteste Tochter des Paares, Maria, wurde 1874 sechs Monate nach der Hochzeit der Eltern geboren; sie besuchte die Dorfschule bei Lehrer Rudolf Biesinger und war seit 1898 in Hailfingen mit dem Postboten Adolph Epple verheiratet. Meine Urgroßmutter Rosa Hess (1875 – 1924) kam im Sommer 1875 als zweites Kind zur Welt. Auch sie besuchte die Schule bei Rudolf Biesinger, musste aber wie ihre Geschwister auch in der Landwirtschaft der Familie helfen. Die jüngere Schwester Katharina Hess (1876 – 1945) folgte ein Jahr später, besuchte die Dorfschule bei Lehrer Rudolf Biesinger und brachte im Alter von 25 Jahren am 22. Mai 1901 „unehelich“ den kleinen Joseph zur Welt, der fünf Monate später verstarb. Im Herbst des Jahres 1902 heiratete Katharina Hess einen Bernhard M. Es ist mir nicht bekannt, ob es sich hier um den Kindsvater handelte. Genovefas vierte Tochter wurde Walpurga genannt (1878 – 1931). Auch Walpurga besuchte die Volksschule bei Lehrer Rudolf Biesinger und heiratete Johannes Evangelist Haug – auch er eines meiner Familienmitglieder. Schließlich kam im Herbst 1880 noch Genovefas Sohn Remigius zur Welt. Dieser besuchte wie seine älteren Schwestern ebenfalls die Dorfschule bei Lehrer Rudolf Biesinger. Der Steinhauer zog nach Blaubeuren und heiratete dort – wie der Wurmliger Pfarrer im Kirchenbuch vermerkte, am 23. Juli 1907 Anna Bloching von Seihsen – und zwar „evangelisch“
– pfui Teufel!
Über das Ableben von Genovefa Baur ist bislang noch nichts bekannt, ihr Ehemann Johannes Hess verstarb im Alter von „66 Jahre[n], 4 Monate[n], 5 Tage[n]“ am Donnerstag, den 14. April 1910 „morgens um 6 Uhr“ an „Influenza, Lungenentzündung“ in Wurmlingen. Die Beerdigung fand am Sonntag, den 17. April „nachmittags ½ 4 Uhr“ statt.
Wie bereits oben erwähnt, gibt es von meiner Urgroßmutter Genovefa Hess eine Fotographie. Das Datum der Aufnahme ist unbekannt, sie zeigt die schon alte, ein Kopftuch tragende Ururgroßmutter möglicherweise in ihrer Wohnstube. Eine meiner Tanten ist ihr übrigens wie aus dem Gesicht geschnitten.